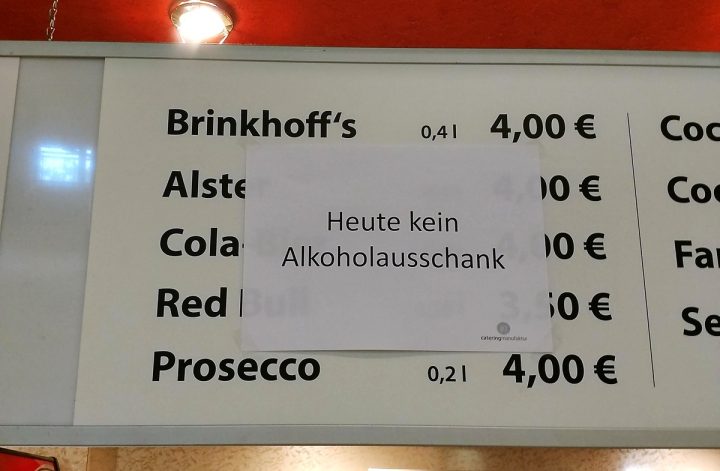Andreas Görgen, der Ministerialdirektor der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, gilt als einer der mächtigsten Männer der Kulturszene in Deutschland. Doch seine Zeit läuft ab.
Bei der Eröffnung der Internationalen Kurzfilmtage am 1. Mai in der Lichtburg, dem Traditionskino mitten in der Oberhausener Fußgängerzone, ergriff direkt nach NRW-Kulturministerin Ina Brandes ein Mann das Wort, der zu den mächtigsten Kulturpolitikern der Republik gehört, aber selbst noch nie in der ersten Reihe stand: Andreas Görgen, der Ministerialdirektor der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. In seiner Rede erinnerte er an den legendären SPD-Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann, der 1954, als er damals Leiter der Oberhausener Volkshochschule war, die Kurzfilmtage gründete. Görgen durfte Hoffmann, wie er sagt, noch persönlich kennenlernen, als der Präsident des Goethe-Instituts war. Er berichtet davon, wie er in seiner Zeit als Mitarbeiter des Berliner Ensembles unter Heiner Müller in den 90er Jahren „nach Oberhausen fahren durfte“. Er richtet die Grüße von seiner Chefin Claudia Roth, der Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, aus und nähert sich mit Bedacht dem Thema, mit dem die Kurzfilmtage 2024 über Monate hin für Schlagzeilen sorgten: Israelhasser hatten das Festival und seinen Leiter Lars Henrik Gass über Monate unter Druck gesetzt und zum Boykott der Kurzfilmtage aufgerufen, weil er sich nach den Pogromen der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres mit Israel solidarisiert hatte. „Es war mir ein Anliegen“, sagte Görgen in der Lichtburg zu Gass, „heute Abend hier zu sein und zu sagen: Wir schützen Sie.“ Das Haus von Roth verteidigt die Freiheit „der Intendantinnen und Intendanten der Kultureinrichtungen“ und die Kurzfilmtage Oberhausen. Der Kampf gegen den Antisemitismus und gegen jeden Exklusionsmechanismus sei ein täglicher Kampf. „Sie kennen die Politik der Bundesregierung, sie wissen um unsere Freundschaft und Solidarität mit Israel, sie wissen vielleicht auch, dass wir als erstes Land im Januar gemeinsam mit Kulturinstitutionen nach Israel gefahren sind, um unsere Solidarität zu zeigen, um mit den Freunden in Israel zu arbeiten.“ Görgens Worte bei der Eröffnung der Kurzfilmtage waren für einige im Saal der Lichtburg überraschend, galt Görgen bislang nicht gerade als einer der größten Freunde Israels. Die Verfasser des Aufrufs ‘GG 5.3 Weltoffenheit’, der sich gegen den Beschluss des Bundestages wandte, Unterstützer der antisemitischen BDS-Kampagne, deren Ziel die Vernichtung Israels durch Boykotte ist, finanziell nicht mehr zu fördern, der von den Managern der wichtigsten deutschen Kulturinstitute wie dem Goethe-Institut, dem Haus der Kulturen der Welt, der Kulturstiftung des Bundes und vielen anderen unterzeichnet wurde, dankten Görgen im Dezember 2020 „für fachlichen Rat und Diskussionsbeiträge“.
Als nach Recherchen des Bündnisses gegen Antisemitismus Kassel Anfang 2022 klar war, dass antisemitische Aktivisten beim Kunstfestival Documenta dabei sein würden, sorgte sich Görgen – wie aus E-Mails an die Documenta-Leitung hervorgeht, die von der Welt veröffentlicht wurden. Görgen schloss einen politischen Eingriff auf das Festival nahezu aus: „So weit wie immer möglich sollten wir vermeiden, dass Regeln des politischen Diskurses die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Kunst und der Wissenschaft beschränken.“ Der folgende Skandal erschütterte nicht nur die Documenta, sondern setzte auch seine Chefin unter Druck. Auch die umstrittene Neukonzeption der Gedenkstättenpolitik des Bundes, die nach Ansicht von Kritikern zu einer Abwertung der Shoah führen könnte, soll nach einem Bericht der Welt seine Handschrift tragen.
Will man über Görgen, den „Schattenmann der Bundesregierung“, wie ihn die Kunstzeitung einmal nannte, reden, ist es schwer, Gesprächspartner zu finden. Anfragen werden nicht beantwortet, und wer bereit zu einem Gespräch ist, legt Wert darauf, nicht namentlich genannt zu werden. Für einen Antisemiten hält ihn niemand. Den Israelfreund nehmen ihm wiederum ebenfalls nicht alle ab. Bereitet sich Görgen auf einen Regierungswechsel nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr vor und versucht, sich entweder für seine jetzige Stelle oder eine attraktive Anschlussverwendung zu empfehlen? Dass er, sollte nicht mehr die Grüne Roth oder ein Sozialdemokrat für Kultur im Bund zuständig sein, gilt sein berufliches Ende als gesichert. Eine neue Regierung könnte ihn in den Ruhestand versetzen.
Görgen, heißt es, habe sich nicht aus Sympathie gegenüber Israelkritikern offen gezeigt, sondern aus einem Denken heraus, dass davon ausgeht, dass Offenheit, Diskussion und nicht Ausgrenzung Konflikte lösen würden. Ein sozialarbeiterischer Ansatz, der nicht ganz zu einem promovierten Juristen zu passen scheint. Widersprüchlich sind auch die Beschreibungen seines Auftretens: Einige bezeichnen ihn als arrogant und aggressiv, andere als offen. Vielen gilt er als das ‘Gehirn’ von Claudia Roth, wie er es auch schon bei Michelle Müntefering gewesen sei, als er für sie im letzten Kabinett Merkel arbeitete, dem die Hernerin als Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt angehörte und die nach Ansicht der Kunstzeitung in ihrem Amt in Berlin eher „unbeholfen“ agiert hätte.
Was sagt der „Schattenmann“, Deutschlands mächtigster Kulturpolitik-Manager, zu alledem? Eine Gesprächsanfrage ignorierte Görgen, eine persönlich an ihn gerichtete schriftliche Anfrage ließ er durch Mitarbeiter der Pressestelle beantworten. Die Nennung auf der Webseite von GG Weltoffenheit sei ohne seine Zustimmung erfolgt. Als Abteilungsleiter für Kultur und Kommunikation habe er selbstverständlich für Diskussionen und Beratungen zu Fragen der Auswärtigen Kulturpolitik zur Verfügung gestanden. „Bei all seinen Gesprächen machte Herr Görgen die Positionen des Auswärtigen Amtes zum Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus deutlich.“ Eine Floskel, mehr nicht.
Natürlich sehen sich auch die Unterzeichner von GG Weltoffenheit nicht als Antisemiten. Ihnen ging es nur darum, Antisemiten weiterhin den Zugriff auf Steuergelder zu ermöglichen. Offenbar hat Görgen ihnen nicht geraten, von ihrem Vorhaben abzulassen und den BDS-Beschluss des Bundestages als das zu verteidigen, was er war: Ein früher Versuch, Antisemiten im Kulturbereich entgegenzutreten. Hätte er es getan, sie hätten ihm kaum gedankt.
Aussagen anderer über sein Verhalten mag Görgen nicht kommentieren. Und was wird aus ihm nach der nächsten Bundestagswahl? Wie es sich für einen Beamten gehört, fügt er sich in sein künftiges Schicksal: „Für Herrn Görgen als Bundesbeamten hängt seine berufliche Zukunft von der Entscheidung seines Dienstherren ab.“ Görgen gilt als gebildet und blitzgescheit, ein Intellektueller, der sich bestens in seinem Metier auskennt. Man kann das beim besten Willen nicht über alle seine Vorgesetzten der vergangenen Jahrzehnte sagen. Steinmeier kam in jedem seiner Ämter nie über das Niveau einer Phrasendreschmaschine hinaus, Müntefering versuchte vergeblich, durch muntere Videos zu interkulturellen Themen zu punkten.
Auf die Frage, was er davon hält, als das ‘Gehirn’ von Roth und Müntefering bezeichnet zu werden, lässt er mit Verweis auf sein Beamtendasein antworten und nennt zugleich die vielen prominenten Politiker, denen er diente: „Als Beamter des Auswärtigen Amtes unterlag Herr Görgen der Treue- und Folgepflicht gegenüber seinem Dienstherren, den Außenministern Steinmeier, Maas und Gabriel bzw. ihren Staatssekretärinnen, Staatssekretären und Staatsministerinnen, namentlich Staatsministerinnen Böhmer und Müntefering. Als Beamter der BKM unterliegt er der Treue- und Folgepflicht gegenüber Staatsministerin Roth. Wie jeder Beamter hat er seine Amtspflichten zu erfüllen und sich mit vollem persönlichen Engagement seinem Beruf zu widmen. Insofern wird Ihre Fragestellung der Aufgabenbeschreibung eines Beamten nicht gerecht.“
Görgen begann seine Karriere in einer Zeit, als die Kunstfreiheit gegen Konservative geschützt werden musste. Mittlerweile dient sie häufig Antisemiten, um gegen Israel und Juden zu hetzen. Die postkolonialistischen Diskurse prägen seit Jahren die Kulturszene, zu der auch Görgen gehört. Viele, das zeigt GG Weltoffenheit, haben sich um Anschlussfähigkeit an diese Szene bemüht. Görgen, sagen manche, habe die postkoloniale Welle geschickt genutzt, aber ganz dabei war er nie. Nun geht er auf Abstand. Die postmodernen Ideologien sind kein Gewinnerthema mehr. Sie sind toxisch geworden. Der Mann im Hintergrund hat allerdings auch verpasst, früh klar Stellung zu beziehen. Für die Diskursverschiebungen der vergangenen Jahre trägt er somit seinen Teil der Verantwortung. Wenn er im kommenden Jahr tatsächlich Macht und Einfluss verlieren würde, wäre das die Grundlage einer Neuorientierung der Kulturpolitik des Bundes.
Der Text erschien in ähnlicher Form bereits in der Jungle World