 Die letzte Phase der Gentrification, die der Scene-Changers überlappt sich insofern, dass die Scene-Seekers, wenn sie denn dauerhafte Bewohner werden, selbst in die Rolle der Scene-Changer schlüpfen. Es kommen aber jetzt auch die hinzu, die mit der Szene vorher nicht einmal als Besucher was zu tun hatten. Sie suchen ganz allgemein nach Wohn- und Lebensraum in New York und bekommen von Experten oder Freunden den Tipp „Upcomming Williamsburg“.
Die letzte Phase der Gentrification, die der Scene-Changers überlappt sich insofern, dass die Scene-Seekers, wenn sie denn dauerhafte Bewohner werden, selbst in die Rolle der Scene-Changer schlüpfen. Es kommen aber jetzt auch die hinzu, die mit der Szene vorher nicht einmal als Besucher was zu tun hatten. Sie suchen ganz allgemein nach Wohn- und Lebensraum in New York und bekommen von Experten oder Freunden den Tipp „Upcomming Williamsburg“.
Die Szene dort interessiert sie nicht im Geringsten, sondern nur das, was sie als Ambiente und als Infrastruktur geschaffen hat. Das kann man ihnen auch nicht für Übel nehmen, denn so läuft Marktwirtschaft nun mal.
Aber sie bedeuten damit unausweichlich eine neue Stufe des Wandels. Zum einen weil sie gleich auf dem höchsten Mietniveau einsteigen, weil sie es auch bezahlen können und dafür natürlich auch Entsprechendes erwarten. Sie gehören deswegen in der Regel auch einer anderen sozialen Schicht, auf jeden Fall aber einer wesentlich höheren Einkommensklasse an als alle bisherigen Bewohner. Zum anderen beteiligen sie sich so gut wie gar nicht an den bestehenden bzw. gewachsenen sozialen Strukturen und Organisationen und bilden stattdessen eher ein eigenes Milieu aus. So auch in W-Burg.
Selbst die örtliche Kunstszene ist für sie eher Ambiente, denn Treffpunkt oder Raum des eigenen Engagements. Das gleiche gilt erst recht für die Beteiligung an den örtlichen Mieterorganisationen, die sich in W-Burg zunehmend im Abwehrkampf gegen die immer höheren Mieten befanden und noch befinden. Meistens bildet diese Kategorie der Zuzügler gerade in New York,aber nicht nur dort, auch eher Eigentum, als dass sie zur Miete wohnen wollen. Konflikte zwischen den Kreativen und diesen sogenannten Yuppies wurden so auch in Williamsburg unvermeidlich. Aber auch von den ursprünglichen polnischen und lateinamerikanischen Einwohnern ist diese Gruppe der neusten „Invasoren“ nur wenig gelitten.
Das alles spiegelte und spiegelt sich auch im Straßenbild wieder. Der Bohemien- bzw. der Buntheitsfaktor nahm in den letzten Jahren massiv ab. Das Schaulaufen derer, die unbedingt auffallen wollen, nahm dagegen kontinuierlich zu. Das Viertel ist jetzt auch offiziell hipp, denn es steht so in den New Yorker Reiseführen und in weltweiten Szenemagazinen. Deswegen tauchen auch die ersten Promis auf, zumindest aber wird jetzt vermutet, dass man dort entdeckt werden könnte, wenn man nur genügend aufgedreht rum läuft. Von einem Galeristen, Literaturagenten, Regisseur usw. Egal ob der in Williamsburg als Scout unterwegs ist oder vielleicht dort sogar fest wohnt.
Fotografiert und gefilmt wird in Williamsburg schon länger und viel, und zwar von den unzähligen Kunststudenten und Künstlern die dort wohnen. Aber die richtigen Shootings der Meister aus Manhattan haben länger auf sich warten lassen. Einer der ersten habe ich selbst noch auf dem Dach bei S. erlebt. Die Locationscouts der New Yorker Filmgesellschaften und Fotoagenturen suchen wie überall auf der Welt nun mal immer neue und interessante Orte. Filmleute habe auf Grund ihrer normalen Security auch nicht ganz soviel Angst vor Straßenüberfällen. Deswegen ist eine Vorhut von ihnen schon kurz nach der ersten Künstlerwelle aufgetaucht.
Der erste große Hollywoodlike-Film der Williamsburg ins internationale Licht rückte kam jedoch erst später: „Perfect Murder“ mit Michael Dougles. Eines der Fabriklofts in Greenpoint war dabei eines der wichtigsten Aktionsstätten und ein dubioser Künstler nahm im Plot auch eine mörderische Hauptrolle ein.
Die ersten Locationsscouts kamen aber nach Williamsburg weil dort der spektakuläre Blick auf Manhattan von den Dächern aus auch noch billig zu kriegen war. In Manhattan kostete selbst die kurzeitige Nutzung solcher Spannungsorte zu dem Zeitpunkt noch locker das 10 fache. Heut sind auch dafür die Preise in Williamsburg mit den sonstigen Mieten enorm angestiegen.
Vor ein paar Jahren wurde ich mehrfach im Stadtteil angesprochen, weil ich irgendeinem berühmten Schauspieler aus einer bestimmten Perspektive und bei etwas weniger Licht offensichtlich sehr ähnlich sah. Meine Zeit als Promi-Copy währte allerdings nur eine Woche. Die Tatsache, dass ich schon über viele Jahre so regelmäßig und jeweils lange genug vor Ort war, so dass neben meinen Arbeitspartnern und Freunden mich auch Nachbarn immer wieder erkannten und begrüßten, ja um meine genau Herkunft wussten, tat das seinige dazu.
Ich saß nach getaner Arbeit sehr oft am Abend auf einer der vor den vielen Szeneläden gestellten kleinen Bänke, auf denen man den Passanten auf der Bedford , so lange wie man wollte, zusehen konnte. Dabei hatte ich fast immer dieses herrliche New York Village Gefühl, was man in Manhattan zwar auch haben kann, nicht aber so relaxt. So bekam ich über die Zeit auch die Änderungen der Streetstyles und damit die soziale Zusammensetzung der Szene in ihrer äußeren Erscheinung mit.
Williamsburg wurde wirklich weltweit tonangebend. Hier habe ich fast alle szenigen Modeänderungen immer gut ein bis 2 Jahr eher mitbekommen, als sie in Berlin ankamen. Z.B. das man oder besser frau knallbunte Gummistiefel auch im Sommer trägt, oder die jungen Männer Hütchen und Bärtchen und die jungen Frauen Tag und Nacht riesige Sonnenbrillen. Single Speeds, d.h. Fahrräder ohne Gangschaltung und Fixies , d.h. Fahrräder mit feststehender Hinterradnarbe ohne Gangschaltung und Bremsen, wurden hier mindesten 5 Jahr eher als in Berlin gefahren. Das erste Single Speed in Deutschland habe ich allerdings in meinem Lieblingsfahrradladen im Bochumer Bermuda3Eck entdeckt. Weit bevor die Berliner überhaupt wussten, was das überhaupt ist.
Streetstylemäßig war allerdings der Wandel W-Burgs am deutlichsten an einer neuen Art von Hunden zu sehen , die vorrangig auch jetzt die jungen Frauen mit sich führten. Nach dem das Sicherheitsproblem auf den dortigen Straßen endgültig gelöst war, gab es lange Zeit keine Hunde mehr in W-Burg. Jetzt tauchten statt der damaligen richtigen Hunde zunehmend Zier- und Spielhündchen an der Seite der junger Leute auf. Der Weg vom Kampfhund zum Schoßhündchen zeigt am klarsten worum es in New York bei der Gentrification neben Infrastruktur und Urbanität am meisten geht: Um Sicherheit.
Aber auch die vielen individualistischen modischen Einzelinnovationen, von denen ich schon in einem der anfängliche Folgen berichtet habe, nahmen jetzt exponentiell zu. Eine junge Gruppe von Williamsburger Modedesignern hatte vorher schon das heute auch in Manhattan, und demnächst sicher auch in Europa in Erscheinung treten werdende Label „Booklyn Industries“ ins Leben gerufen.
Den ersten richtigen Verkaufsladen gab es natürlich an der Bedford nahe North 7th. Und natürlich den Stress mit der Lokal-Szene wegen des zunehmenden „kapitalistischen“ Erfolgs per Graffiti auf den Schaufenster und Türen der Boutique. Den gibt es allerdings seit Beginn der immer noch aktuellen Phase des Scenechanging nicht mehr.
Vielmehr ist neuste Mode jetzt auf der Bedford und drum herum normal. Auch die von „Brooklyn Industries“. Der noch verbliebene individuelle Style, neuerdings Controverse (Self)design genannt, weil jeder Style jetzt auch seinen Namen haben muss, denn Williamsburg ist jetzt „maßgebend“, also „supercool“, ist dadurch immer anstrengender geworden. Er wird schnell in der Szene selbst, dank Style Book auch weltweit, kopiert, weil was wirklich Neues auch in den heute sogenannten Kreativvierteln dieser Welt kaum noch einem einfällt.
Der Trend geht deswegen in den letzten Jahren vom Künstler zum Künstler(selbst)darsteller, was sich natürlich aus der Natur der Sache immer schon gegenseitig bedingte und wechselseitig spiegelte. In Williamsburg hat das jedoch dazu geführt, dass sich diese beiden inneren Bilder nun rollenmäßig im Straßenbild zunehmend als personell getrennt manifestierten. Als verschiedene Personengruppen.
Die die real kreativ waren und auch davon ihren Lebensunterhalt mit realer Entlohnung bestreiten konnten trennten sich von denen, die sich das wünschten aber nicht schafften. Und erst recht von denen die einfach nur so aussehen wollten. Letztere Gruppe nahm seit der Change-Phase ebefalls rasant zu.
In diesem Viertel hatte man eben auch als Rechtsanwalt oder Broker, oder einfach nur als kunstsinniger Berufserbe oder als Durchschnittsstudent ohne jede besondere Ambition irgendwie kreativ auszusehen. Cool zumindest. Und die Standards dafür setzte und setzt immer noch die Szene bzw. die die sich dazu gehörig fühlten.
Das, was in der sozialen Realität zunehmend zerbrach, funktionierte immer noch als Style. Die Stylisten waren aber nicht mehr die Kreativen, zumindest nicht, wenn sie sich nicht selbst zur Modebranche zählten. Es waren selbsternannte „Kreative“, sozusagen ihre modischer Abklatsch als Lebensaufgabe.
Eine spezielle Gruppe unter ihnen die schon länger W-Burg bevölkerten waren die sogenannt PPA´s, ausbuchstabiert Parent Payed Artists. Sie hatten natürlich richtige, häufig sogar überdurchschnittlich große, Künstlerlofts, machten auch Kunst darin, aber jeder der nur etwas Ahnung hatte wußte, dass das sie weder davon lebten noch jemals davon würden leben können. Das allerdings taten sie über Jahre. Und sie trugen fast immer Klamotten und Schuhe auf den Spuren künstlerischer Arbeit sichtbar waren.
Die erfolgreichen Kreativen dagegen zogen und ziehen sich zunehmend aus dem Straßenleben zurück. Zumindest als Selbstdarsteller. Sie benutzen sie zunehmend wie die zu gezogenen Scene-Changer nur noch als Ambiente und Infrastruktur. Die Kreativendarsteller dagegen übernahmen und übernehmen weiterhin die Straße in einer Weise, dass es für den Eingeweihten schon eine lächerliche Note bekommen hat. From being cool to being a fool it´s only a little step. Die wirklich Coolen suchen derweil schon nach neuen Treffpunkten für die wirklichen In-People. Für die, die nicht mehr unbedingt anders sein wollen aber dafür nur noch unter sich. Wie in Manhattan eben.
Oder wie in einem Teil von Williamsburg, an dem der ganze Hype spurlos vorüber gegangen ist, obwohl dort die Leute wohnen, die wahrscheinlich am meisten an der Gentrification ihres Stadtteils verdient haben. Aber dazu in der letzen Folge.
Was bisher geschah:
Die Willamsburg Story I…Klack
Die Willamsburg Story II…Klack
Die Willamsburg Story II…Klack
Die Williamsburg Story IV…Klack
Die Williamsburg Story V…Klack
Die Williamsburg Story VI…Klack
Die Williamsburg Story VII…Klack
Die Williamsburg Story VII…Klack




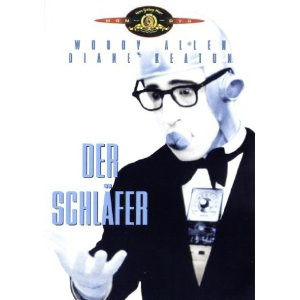


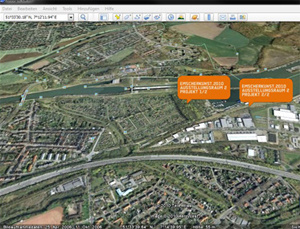

 Das jüdisch-orthodoxe Williamsburg liegt, wie ich schon in einer der ersten Folgen erwähnt habe, südlich der Williamsburg Bridge.
Das jüdisch-orthodoxe Williamsburg liegt, wie ich schon in einer der ersten Folgen erwähnt habe, südlich der Williamsburg Bridge. Die letzte Phase der Gentrification, die der Scene-Changers überlappt sich insofern, dass die Scene-Seekers, wenn sie denn dauerhafte Bewohner werden, selbst in die Rolle der Scene-Changer schlüpfen. Es kommen aber jetzt auch die hinzu, die mit der Szene vorher nicht einmal als Besucher was zu tun hatten. Sie suchen ganz allgemein nach Wohn- und Lebensraum in New York und bekommen von Experten oder Freunden den Tipp „Upcomming Williamsburg“.
Die letzte Phase der Gentrification, die der Scene-Changers überlappt sich insofern, dass die Scene-Seekers, wenn sie denn dauerhafte Bewohner werden, selbst in die Rolle der Scene-Changer schlüpfen. Es kommen aber jetzt auch die hinzu, die mit der Szene vorher nicht einmal als Besucher was zu tun hatten. Sie suchen ganz allgemein nach Wohn- und Lebensraum in New York und bekommen von Experten oder Freunden den Tipp „Upcomming Williamsburg“. 