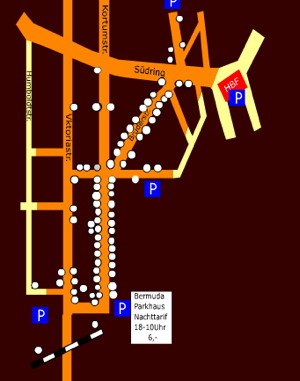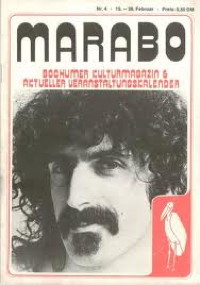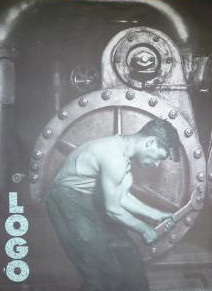Dirk Steinbrecher, weniger an kleidnerische Eleganz interessiert und nicht so eloquent wie Johannes Dittfeld, jedoch organisatorisch genau so begabt und vor allem immer noch erfolgreich im Dreieck aktiv, begann 1986 seine „Kneipenkarriere“ mit 21 Jahren im Mandragora, im Ausschank des dazugehörigen Biergartens auf dem Konrad-Adenauer-Platz. „Ich begann ein Jahr zuvor mit meinem Maschinenbau-Studium und da ich schon als Jugendlicher immer nebenbei gejobbt habe, suchte ich nach einer festen Aushilfsstelle, um meinen Eltern nicht allzu sehr auf der Tasche zu liegen. Da ich schon länger Gast im „Mandra“ war, lag es nahe dort zu arbeiten, wo man sich auch privat wohl fühlt. In die Gastronomie einzusteigen hatte ich damals nicht vor.“
Dirk Steinbrecher, weniger an kleidnerische Eleganz interessiert und nicht so eloquent wie Johannes Dittfeld, jedoch organisatorisch genau so begabt und vor allem immer noch erfolgreich im Dreieck aktiv, begann 1986 seine „Kneipenkarriere“ mit 21 Jahren im Mandragora, im Ausschank des dazugehörigen Biergartens auf dem Konrad-Adenauer-Platz. „Ich begann ein Jahr zuvor mit meinem Maschinenbau-Studium und da ich schon als Jugendlicher immer nebenbei gejobbt habe, suchte ich nach einer festen Aushilfsstelle, um meinen Eltern nicht allzu sehr auf der Tasche zu liegen. Da ich schon länger Gast im „Mandra“ war, lag es nahe dort zu arbeiten, wo man sich auch privat wohl fühlt. In die Gastronomie einzusteigen hatte ich damals nicht vor.“
Nach der ersten Sommersaison wurde ihm das Privileg zuteil, im Mandragora an der Theke zu arbeiten. Als in der Küche jemand ausfiel, sprang er auch dort ein, und langsam entdeckte er die Gastronomie für sich. Drei Jahre später leitete er für den damaligen Pächter den gesamten Biergarten mit an die 100 Mitarbeitern, meist studentische Aushilfen. Mitte der 90er gab es kaum Chancen, als Ingenieur eine Stelle zu bekommen, und so entschied er sich kurz vor Beendigung seines Studiums spontan dieses abzubrechen und bei Leo Bauer in die kaufmännische Lehre zu gehen.
Sein „Gesellenstück“ war mit Sicherheit die Wiedergeburt des Biercafés am Schauspielhaus, eine Heba-Kneipe die nicht mehr lief und für die man auch keinen Pächter fand. Bauer, pragmatisch wie er bis heute ist, sagte damals zu Steinbrecher: „Dann machen wir das eben selber“. Bis heute betreibt ein ehemaliger Mitarbeiter von Steinbrecher diese Kultur-Kneipe mit Erfolg.