
Eigentlich wollte ich hier nicht über den Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Jürgen Großmann, schreiben. Die Personalie ist zu heikel. Zu schnell kann man sich die Finger verbrennen – für lange Zeit.
Foto: RWE
Aber: es geht nicht anders. Die Wirtschaftswoche schreibt schon vom Unmut beim RWE, der sich über den Manager auflädt. Ich weiß, dass Großmann sich auch schon mal bei RWE-Vorstands-Sitzungen zum Verdruß der übrigen RWE-Chefs von einem Vertrauten vertreten läßt. Dass er manchmal Tagelang nicht im Konzern auftaucht. Das sorgt für miese Stimmung.
Tja, und dann weiß ich, dass Großmann nicht besonders gut Späße versteht. Zumindest nicht, wenn es um den Spruch: "VoRWEg gehen" geht. Neulich gab es deswegen eine Telefonkonferenz. Manager des Konzerns wurden da gedrängt, Witze über den neuen Slogan bei ihren Untergebenen zu unterbinden. Jeder, der etwa über einen „iRWEg“ schwadroniere, oder von einem „VoRWErk“-Staubsauger spreche, müsse sich fragen lassen, ob er noch im richtigen Unternehmen arbeite. Der Slogan „VoRWEg gehen“ spiegele schließlich die Philosophie des zweitgrößten deutschen Energiekonzerns wieder. Das sei ernst gemeint, hieß es noch. Kurze Zeit später wurde auf einer Tagung ein Zettel herumgereicht. Darauf stand: „Kein Unfug! Sonst eRWErbslos“.
Für Jürgen Großmann läuft es auch acht Monate nach seinem Dienstantritt noch nicht rund beim Energieriesen RWE, das kann keiner sagen. Immer noch wandern Hunderttausende Kunden ab, der Verkauf der Wasser-Sparte in Amerika bringt weniger als erwartet und dann bricht auch noch Streit mit den wichtigsten kommunalen Anteilseignern aus.
Viel Pech für nur einen Mann. Dabei hat Großmann einige Erfolge vorzuweisen. Der Manager hat den Konzern aus seiner Starre gerissen und mit der Gründung von RWE Innogy den längst überfälligen Einstieg in die Erneuerbaren Energien geschafft. Auch der angekündigte Verkauf der Gastransportnetze bringt dem Konzern neue Freiheiten. „Das Gasgeschäft können wir trotzdem wie geplant entwickeln. Besser noch, wir werden wieder politisch handlungsfähig“, heißt es aus dem Umfeld des Konzernlenkers. „Wir müssen handeln, solange wir können. Wenn wir gezwungen werden, ist es zu spät.“ Großmann bewegt.
Doch gerade die Anstöße sorgen im weit verzweigten Netz des RWE für teils unkontrollierbare Schwingungen. Da wird zum Beispiel genüsslich aus dem Aufsichtsrat kolportiert, dass der Milliardär und Eigentümer des Stahlwerks Georgsmarienhütte sich seinen zwei Millionen Euro schweren Beitrag zur Alterssicherung aufs Privatkonto überweisen lässt. Und zwar jedes Jahr zusätzlich zu seinem Gehalt von sechs bis sieben Millionen Euro. Normalerweise würde man eine Pensionsrücklage erwarten. Sein Gehalt über die Vertragslaufzeit von fünf Jahren beträgt damit rund 40 Mio Euro. Ein Spitzenwert in der deutschen Wirtschaft.
Aber es sind nicht diese Sticheleien, die Großmann zusetzen. Der Kapitalmarkt ist härter. Selbst die durchaus anerkannten Erfolge reißen Analysten wie Theo Kitz von der Privatbank Merck & Finck nicht mehr vom Hocker: „Im Vergleich geht E.on vor und RWE zieht nach. RWE ist nur kleiner und immer zweiter. Das sehen auch die Anleger so.“ Der Börsenwert von RWE liegt bei rund 43 Mrd Euro. Branchenprimus E.on bringt rund 90 Mrd Euro auf das Parkett. Die Bank Merrill Lynch setzt RWE auf „Neutral“ und hält E.on auf „Kaufen“.
Eine Ursache für die Zurückhaltung im Geldhandel liegt im misslungenen Börsengang von American Water. Auch der Verkauf des zweiten Aktienpaktes Ende Mai lief nicht wie gewünscht. Statt der angebotenen 8,7 Mio Papieren konnten nur 5,17 Mio an Investoren gebracht werden. Schon der Verkauf des ersten Pakets lief schlecht. Statt der vorgesehenen 26 Dollar pro Aktie konnten nur 21,50 Dollar erlöst werden. In der Folge schmolz der Ertrag auf 1,2 Milliarden Dollar, fast die Hälfte zu den Planungen. Großmann musste eine Gewinnwarnung aussprechen.
Aus dem Großmann-Umfeld heißt es zu den Problemen: „Das Glas ist halbvoll, nicht halbleer.“ Noch gebe es genug Gründe für Optimismus. Allen voran die politische Bedeutung von RWE wird unter Großmann wieder sichtbar. Der Konzernchef ist in regelmäßigen Kontakten mit der Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel akzeptiert den Manager als Ideengeber genauso wie die SPD-Mächtigen um Frank-Walter Steinmeier. Selbst mit Umweltminister Sigmar Gabriel werde nach jahrlangem Schweigen wieder gesprochen.
So kann der Konzern effektiv für eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke eintreten. Unter dem Großmann-Vorgänger Harry Roels herrschte eine angeordnete politische Ruhe, die RWE zu einem Spielball der Gewalten werden lies. „Wir haben jemanden gebraucht, der uns wieder auf öffentlicher Bühne vertritt“, heißt es aus dem Konzern. Großmann setze sich mit aller Kraft für RWE ein.
Und das ist dringend nötig. In etlichen Prestige-Baustellen läuft etwas schief. Kaum hat der Konzernlenker durch den Verkauf der Gasnetze ein Kartellverfahren der EU abgewendet, wird die Nachricht herumgereicht, dass sich der Bau der transkontinentalen Gaspipeline Nabucco auf nahezu 7,5 Mrd Euro verteuert. Fast doppelt soviel wie geplant. „Das Projekt ist aber nicht gefährdet“, heißt es aus der RWE-Spitze. „Nabucco kann immer noch rentabel arbeiten.“
Selbst die Übernahme des Kernkraftwerkbetreibers British Energy wächst sich zu einem Sommertheater aus. Zunächst wurde der deutsche Konzern mit seinem vorgesehenen Partner Vattenfall als Favorit gehandelt. Gemeinsam wollten die Stromriesen den größte Energieerzeuger Großbritanniens für knapp 14 Milliarden Euro übernehmen und unter sich aufteilen. Doch dann unterband die schwedische Regierung den Einstieg des Staatskonzerns Vattenfall ins Inselreich. Pech für RWE. „Das hätte der Chef von Vattenfall besser organisieren müssen“, heißt es in der Essener Zentrale. Großmann trage da keine Verantwortung.
Allerdings muss er unter den Folgen leiden. Denn RWE könnte die acht Kernkraftwerke der Briten gut gebrauchen. Als Braunkohleverstromer stößt der Konzern das meiste Kohlendioxid in Europa aus. Ab 2013, wenn die CO2-Zertifikate noch einmal teuerer werden, drohen aus den jetzigen Geldkühe Geldfressern zu werden. Deshalb muss eine Entlastung in der Strom-Produktion schnell gefunden werden. Etwa indem die CO2-intensiven Braunkohlemeiler gegen Klimagasneutrale Kernkraftwerke austauscht werden.
Unter diesem Vorzeichen versucht Großmann auch den Verkauf des Gasnetzes voranzutreiben. Nach Informationen aus dem Konzern will er die Gasanlagen gegen saubere Kraftwerke eintauschen. Gerne auch im Ausland. „Das ist die wichtigste Aufgabe in der Zukunft“, sagt ein Insider. "Großmann packt es an."
Doch nicht nur diese Baustelle ist für den Manager Großmann wichtig. Immer wieder mehr reißen neue Löcher auf. Dann stürzt sich der Chef in die anstehenden Aufgaben, ohne die alten abgeschlossen zu haben. „Manche Mitarbeiter erwarten mehr Kontinuität“, heißt es in der RWE-Spitze. Aber die kommt nicht. „Für die Details sind andere verantwortlich“, heißt es aus dem Großmann-Umfeld.
Beispielsweise bei dem Kampf um neue Kunden. Seit Januar haben mindestens 200.000 Haushalte ihre Verträge mit RWE gekündigt, berichtet RWE-Finanzvorstand Rolf Pohlig. Im vergangen Jahr hatte der Konzern bereits eine Viertelmillion Kunden verloren. Der Menschenstrom hat bereits Auswirkungen auf das Ergebnis des Konzerns. Der Betriebsgewinn ging im ersten Quartal um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zurück. Der für die Dividenden entscheidende Nettogewinn brach gar um fast die Hälfte auf 809 Millionen Euro ein, neben dem gescheiterten Börsengang von American Water sei dafür auch der Kundenschwund verantwortlich, bestätigt Pohlig.
Großmann schlägt nun immer wieder neue Angebote vor, um mehr Strom an Privatleute zu verkaufen. Die Rede ist von einer Flatrate, von Preisgarantien oder wie aktuell von einen Atomtarif im Stromhandel. Mit der Exklusivversorgung aus Kernkraftwerken könne jeder Deutschen seine Verbundenheit mit dieser Art der Stromerzeugung demonstrieren und helfen den Atomausstieg zu stoppen, sagte Großmann öffentlich. Intern kommen die Aktionen gut an. "Großmann geht neue Wege. Nur so können wir Kunden gewinnen", heißt es bei RWE. Auch wenn die Bundes-SPD den neuen Atomtarif politisch ablehnt.
Doch Werbung alleine hilft nicht den Konzern Zukunftsfest zu machen. Die Kosten müssen runter, um den Herausforderungen aus CO2-Abgaben und Regulierung zu begegenen. Großmann treibt deswegen den Umbau des Hauses voran. Alles soll schlanker werden. Die intern kritisierten „unglaublichen Hierarchien“ müssen flacher werden. Bis Oktober sollen die meisten Strukturmaßnahmen umgesetzt werden, heißt es intern. „Das ist ein Herkules-Job mit Nebenwirkungen.“
Bis jetzt sind die Kernpunkte der Maßnahmen bekannt. Allen voran soll die deutsche Vertriebstochter RWE Energy eingedampft werden. Wenn im kommenden Jahr der Vertrag mit dem Vorstandschef der Vertriebs-Sparte Heinz-Werner Ufer ausläuft, soll dessen Stelle nicht wieder besetzt werden. Gleichzeitig würden zentrale Aufgaben auf die Konzernmutter überführt, heißt es aus dem Konzern. Andere Jobs würden nach unten in die Regionalgesellschaften abgegeben. Es bliebe wenig mehr als eine Fassade vom einst mächtigen Vertrieb übrig.
In seinem Bemühen, diesen Umbau hin zu kriegen, sucht Großmann die Unterstützung der Arbeitnehmer. Er unterschrieb eine Jobgarantie bis 2012. Den Lohn erhöhte er um 3,9 Prozent. Zudem sicherte er den Betriebsräten eine weitreichende Mitbestimmung auch in den neuen Tochterfirmen zu. Vor allem zum Gesamtbetriebsratschef Günter Reppien sucht Großmann den engen Kontakt. Er lud den gelernten Elektroinstallateur in sein Osnabrücker Sternelokal "La Vie" ein. Und besuchte den Arbeitnehmervertreter in dessen Heimat Lingen. Einmal gab es einen Rathausempfang, einmal eine Stippvisite an Reppiens Arbeitsplatz im örtlichen Kernkraftwerk. Eine ungewöhnliche Ehre für einen Betriebsrat bei RWE.
Doch während an der Arbeitsfront damit Ruhe herrscht, leistet sich Großmann einen ernsten Konflikt mit seinen wichtigsten Aktionären. Ursprünglich wollten die Städte Bochum und Dortmund gemeinsam mit RWE einen neuen Stadtwerke-Konzern mitten im Pott schaffen. Unter dem Namen Unisono sollte RWE mit 20 Prozent an der gemeinsamen Holding rund um den Versorger Gelsenwasser beteiligt werden. Doch dann forderte Großmann das Wassergeschäft von Gelsenwasser für sich. Nach dem Ausstieg American Water, will er auf dieser Basis die Wassersparte in Europa ausbauen. Die Städte ließen die Gespräche verärgert platzen. „Wir lassen uns nichts diktieren“, sagt ein Spitzenbeamter.
Dabei ist die Macht der Ruhr-Kommunen im Konzern immer noch kaum zu unterschätzen. Sie beherrschen über ein Firmengeflecht nahezu 15 Prozent des RWE-Aktienkapitals. Im Aufsichtsrat sitzen gleich vier kommunale Vertreter. Mit den Arbeitnehmervertretern haben sie die Mehrheit. Um jeden Arbeitsplatz werde gekämpft. Manchmal habe Großmann keine ausreichende Unterstützung, heißt es aus dem Gremium.
Und wieder setzt es Sticheleien aus dem Konzern. Es geht um die Kunst, die im Foyer der RWE-Zentrale ausgestellt wird. Normalerweise hat das RWE für diesen Zweck eine Kooperation mit der Folkwang-Schule in Essen. Doch Großmann gefiel die Kunst nicht. Kurzerhand wollte er die Folkwang-Werke gegen Arbeiten von Markus Lüpertz aus seinem Besitz austauschen. Doch die große Geste kam nicht überall gut an. Es hieß, das RWE sei nicht Großmanns Privat-Konzern. Wenn er die Kunst tauschen wolle, müsse er wenigstens den Vorstand fragen. Großmann setzte einen schriftlichen Umlaufbeschluss in Gang. Er bekam die Zustimmung auf dem Papier. Nur: Jeder beim RWE weiß, dass gerade die Folkwang-Schule in enger Verbindung zum wahrhaften Ruhrbaron Berthold Beitz steht. Man sagt, dessen Leichen liegen alle am Grund des Baldeney-Sees. Aus dem Vorstand wurde deswegen hintenrum Kritik laut. Keiner wollte Beitz nächstes Opfer werden.
So kompliziert ist das Ruhrgebiet. Mittlerweile wird schädliches aus dem RWE-Aufsichtsrat kolportiert: „Wir haben einen Familienunternehmer zum Vorstandsvorsitzenden gemacht. Das ist ein gewisses Riskio.“ Immer wieder überschätze Großmann seine Möglichkeiten. Das müsse besser austariert werden. Zur Not müssten auch die Kommunen ein Aufsichtsrat-Mandat abgeben. „Das schlimmste für uns ist doch, wenn Großmann hinwirft.“




.jpg)
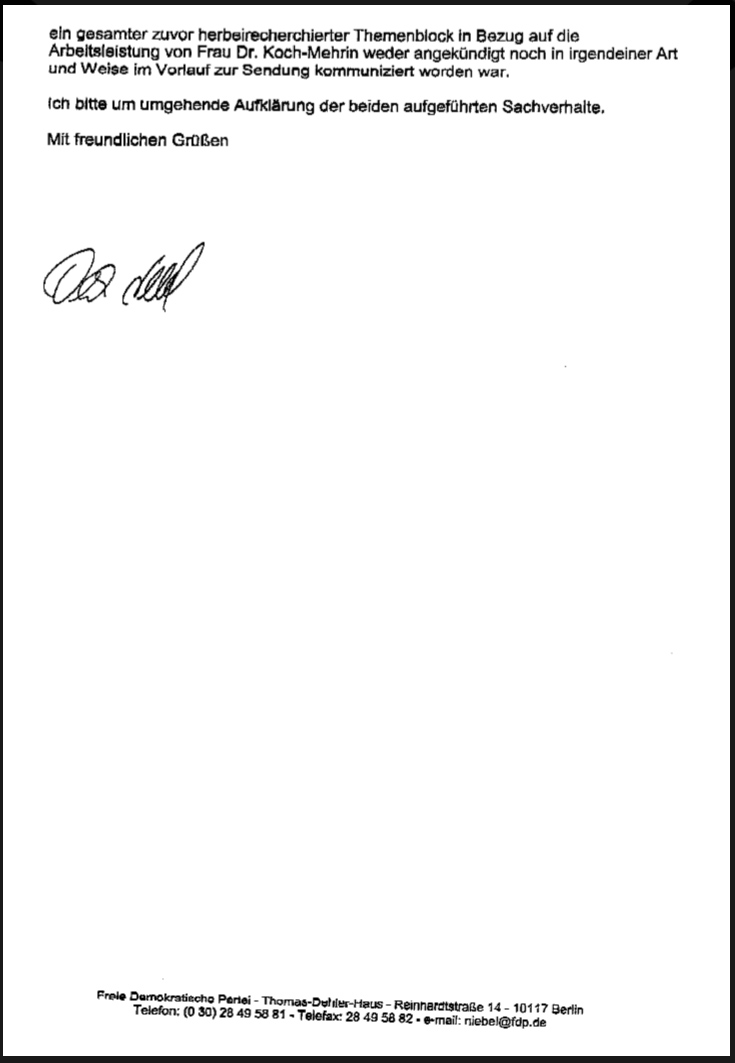
.jpg)
