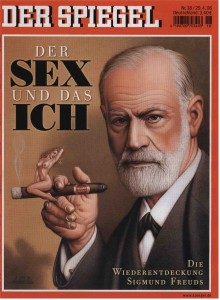Die Ruhr.2010 hört nicht einfach auf, nur weil das Jahr zu Ende ist. Dann müsste auch Schröders Agenda 2010 seit Neujahr Geschichte sein. Die Kulturhauptstadt setzt auf Nachhaltigkeit. Angeblich kamen 10,5 Millionen Besucher. Das klingt gut. Aber selbst das spanische Provinzstädtchen Santiago de Compostela hatte im letzten Jahr 9,2 Millionen Gäste. Gut, da war 1 Papst dabei. An die Ruhr reisten immerhin gleich zwei Bundespräsidenten. Letztlich müssen die Ruhr.2010-Besucherzahlen enttäuschen. Denn in einer Umfrage aus dem Jahr 2008 gaben 69 Prozent der Bundesbürger an, „sicher“ oder „vielleicht“ die Kulturhauptstadt zu besuchen. Das wären immerhin 55 Millionen gewesen. Rückblickend blieb dann doch viel Luft nach oben.
Die Ruhr.2010 hört nicht einfach auf, nur weil das Jahr zu Ende ist. Dann müsste auch Schröders Agenda 2010 seit Neujahr Geschichte sein. Die Kulturhauptstadt setzt auf Nachhaltigkeit. Angeblich kamen 10,5 Millionen Besucher. Das klingt gut. Aber selbst das spanische Provinzstädtchen Santiago de Compostela hatte im letzten Jahr 9,2 Millionen Gäste. Gut, da war 1 Papst dabei. An die Ruhr reisten immerhin gleich zwei Bundespräsidenten. Letztlich müssen die Ruhr.2010-Besucherzahlen enttäuschen. Denn in einer Umfrage aus dem Jahr 2008 gaben 69 Prozent der Bundesbürger an, „sicher“ oder „vielleicht“ die Kulturhauptstadt zu besuchen. Das wären immerhin 55 Millionen gewesen. Rückblickend blieb dann doch viel Luft nach oben.
Anlass für das gestern Abend eigens gegründete Callcenter Ruhr.2011, einmal nachzufragen mit Forsa-Methoden. Mit ungebeten Anrufen zur Abendbrotzeit. Warum die Menschen fernblieben und wie man sie 2011 vielleicht doch noch im Zuge der Nachhaltigkeit hierher locken kann. Erste Stadt: Osnabrück. Gut eine Stunde vom Ruhrgebiet entfernt und mit Kultur nicht allzu arg gesegnet.
Callcenter: „Schüling von der Kulturhauptstadt Ruhr.2011. Haben Sie davon schon mal etwas gehört?“
Herr H.: „Sie wollen mir sicher etwas verkaufen?“
– „Nein, nur nachfragen.“
– „Davon habe ich gehört, auch davon im Fernsehen gesehen.“
– „Viele Bundesbürger hatten vorher die Absicht bekundet zur Kulturhauptstadt zu kommen. Sie waren auch nicht da?“
– „Nein, wir waren auch nicht da.“
– „Gibt es gute Gründe dafür?“
– „Da gibt es eigentlich keine Gründe. Wir hatten auch die guten Vorsätze. Wir haben aus gesundheitlichen Gründen die Fahrt nicht auf uns genommen.“
– „Wir sind ja nachhaltig. Wir haben die Hinweisschilder alle stehen gelassen, die Museen auch. Wir wollen im März das Still-Leben auf der Autobahn wiederholen, aber dieses Mal nicht mit den blöden Tischen, sondern mit Autos, 60 Kilometer Dauerstau. Wäre das was für Sie?“
– „Daran würden wir sicher nicht teilnehmen. Wir hören sehr häufig von… weil wir Cousins und Cousinen in Gelsenkirchen haben. Die jüngste Tochter wohnt in Düsseldorf, so dass wir den Raum mehrmals jährlich wahrnehmen.“
. Fazit: Unentschuldigtes Fehlen. Immerhin ist der Mann schuldbewusst. Wenn man ihn in einen typischen A40-Stau lotsen könnte, würde er den Raum noch intensiver wahrnehmen als ihm lieb ist.
Nächster Umfrageteilnehmer. Herr A., unwirsch. Es ist 19.18 Uhr:
A: „Um diese Zeit rufen mich fremde Leute nicht mehr an!!“ (aufgelegt)
Fazit: Freunde wohl auch nicht.
Der freundliche Herr K. tritt gleich die Vorwärtsverteidigung an.
Herr K: „Ich hatte nicht gesagt, dass ich kommen würde.“
– „Nicht schlimm. Wir arbeiten nachhaltig. Wir reißen die Revierkulisse jetzt nicht ab, nur weil das Jahr vorbei ist. Sie können auch 2011 kommen.“
– „Man hat ja das ein oder andere auf Arte gesehen, aber ich war hier so eingebunden…“
– „Wir haben 60 Millionen fürs Programm rausgehauen, 150 Millionen für neue Museen. Nachher kommen wieder Klagen, von wegen Steuerverschwendung. Daran sind dann aber eigentlich die Leute schuld, die einfach weggeblieben sind.“
– „Ja, da können Sie doch nichts dafür.“
– „Wir wiederholen auch dieses Still-Leben auf der A40. Dieses Mal mit Autos.
– „Autos? Das klingt skurril“
– „Skurril? Ich bitte Sie, Tische auf der Autobahn sind skurril. Wir wollen am 20. März die Autobahn komplett zustauen. Ich hätte da einen Platz für Sie. Ab 13 Uhr, Auffahrt Bochum-Stahlhausen Richtung Essen.“
– „Im Moment… ich weiß noch nicht.“
– „Wir wollen die Strecke komplett dichtmachen, von Dortmund bis Duisburg.“
– „Duisburg, da habe ich gemischte Gefühle. Der Sohn meines besten Freundes ist da auch umgekommen.“
– „Oh, dann ist Duisburg kein gutes Thema. Aber wir arbeiten daran, diesen Oberbürgermeister loszuwerden.“
– „Ja, vielen Dank. Man möchte nicht darüber nachdenken.“
Fazit: Die Toten der Loveparade sind wirklich nachhaltig tot. Sauerland aus dem Amt zu entfernen, wäre mal ein wichtiges nachhaltiges Projekt.
Die nächsten Versuche führen nach Sachsen-Anhalt. Ins Land der Frühaufsteher. Immerhin war die Ruhr.2010 auch ein hervorragendes Angebot an die Ossis, den Westen einmal zu erkunden. Denn kulturell unterscheidet sich der Pott wenig von Orten wie Bitterfeld oder – Dessau.
Frau R: „Erstens sind wir viele hundert Kilometer entfernt, zweitens sind wir beide Rentner. Und bei dem Wetter ins Auto setzen, und eine eventuell verstopfte Autobahn zu erwischen, nein danke.“
– „Wir haben nicht nur im Winter Kultur gemacht…“
„Ich habe einen sehr heißen Draht nach Gelsenkirchen. Mit dem Kumpel schreibe ich schon ewig per Computer. Alles was sich dort tut, kriege ich mitgeteilt. Der schickt mir Fotos, von den Wanderungen, von allem, was sich da abspielt.“
– „Wenn wir einen Reisebus in Ihre Gegend schicken, im Sommer, würden Sie dann vielleicht kommen?“
– „Kommt auf unsere Gesundheit an, die ist zur Zeit ziemlich angeschlagen. Das ist mehr als eine Grippe. Das wäre eine Strapaze, die wäre sehr gut zu überlegen.“
Fazit: Vorsicht. Offensichtlich alte Stasi-Seilschaft in den Westen. Weiß über alles Bescheid. Auch über ominöse Wanderungen. Krötenwanderungen? Linken-Nacktwanderungen auf Halden? Wählerwanderungen? Auf keinen Fall einladen.
Offensichtlich deutlich jünger ist die nächste Befragte, ebenfalls Dessau.
Frau F.: „Wollen Sie jetzt Werbung machen?“
– „Das haben wir nicht nötig. Da sind wir selbstbewusst. Wir hatten Millionen an Steuergeldern zur Verfügung, da muss man keine Werbung machen. Sie haben nichts gehört, etwa von der Loveparade?“
– „Das interessiert mich weniger.“
– „Oder vom Still-Leben, als die Leute auf der Autobahn rumgesessen haben?“
– „Gehört habe ich. Aber das interessiert mich nicht. Ich suche mir meine Angebote selber raus. Schönen Abend noch.“
Fazit: Offensichtlich hat nicht einmal die Super Illu hat über das Duisburg-Massaker berichtet. Kein Ostdeutscher unter den Toten. War ein Fehler. Und das mit dem selber raussuchen, das durften die früher doch auch nicht.
Interessierter erscheint der nächste Umfrageteilnehmer. Er. hat „grob“ von der Kulturhauptstadt gehört.
Callcenter: „Sind wir zu weit weg für Sie?“
Herr O.: „Ja, auch, auch.“
– „Auch?! Spricht mehr gegen uns?“
– „Ja… nee… was heißt jetzt gegen Sie?“
– „Sie können offen reden, die Umfrage ist anonym.“
– „Das Ruhrgebiet kennen wir jetzt nicht so. Es steht aber nicht so für Attraktivität, dass wir uns das touristisch reinziehen würden.“
Auch die Vorstellung des Still-Lebens reloaded fruchtet nicht:
O.: „Wenn Sie den Weg durch die A 2 nehmen, und haben da einen Künstler, der einen Stau anbietet, haben aber schon die ganze Zeit im Stau gestanden und sind froh, dass Sie daraus sind, nee, das ist dann nicht so das Thema. Kann man so nicht sagen.
– „Dessau bietet also genug Kultur?“
– „Kann man so nicht sagen.“
Fazit: Keine Ahnung, aber seine Vorurteile pflegen. Soll die höllische Innenstadt von Dessau genießen. Hätte man das Still-Leben als kollektives Schlangestehen verkauft, wären wahrscheinlich busseweise Menschen gekommen aus dem Land der Frühaufsteher.
Zurück nach NRW, in die Berge, wo schon das Krähen des Hahns als Event durchgeht. In die Stadt, von der es heißt, sie sei schlimmer als Verlieren. Nach Siegen. Eine Stunde bis Dortmund. Frau K., sehr rege, mit englischem Akzent.
Frau K.: „Wir sind aber im Auslandsgebiet, in Siegen.“
– „Das war aber die Europäische Kulturhauptstadt und sollte sogar Menschen aus Stuttgart ansprechen. Na gut, die haben im Moment andere Attraktionen.“
– „Oh, Glasgow war auch mal Kulturhauptstadt. It was a good support for us. Mein Mann ist Däne mit schwedischem Hintergrund, und ich komme aus Schottland.“
– „Da sind Sie mit dem Hintergrund ideale Ansprechpartner.“
– „Jetzt bekomme ich ein schlechtes Gewissen.“
– „Wir wollten damit auch Werbung machen für das Ruhrgebiet.“
– „In Siegen gab es auch ein langes Kulturwochenende. Wahnsinnig viele Leute haben da gesehen, dass Siegen gar nicht so hässlich ist.“
– „Zum Glück war es nicht in Hagen.“
– „Oh, Hagen hat eine sehr gute Oper…“
– „Dann wäre der Day of Song was für Sie gewesen. There was a big concert in Gelsenkirchen, in the football stadium, with about 60 000 participants…“
– „Ich mag solche Großveranstaltungen nicht. Neulich waren wir in Olpe beim Kammerorchester Sankt Petersburg mit einem tollen Flügelhornspieler. Ich kannte ihn nicht, er soll aber sehr berühmt sein.“
Fazit: Der Mann mit dem Flügelhorn heißt Sergej Nakariakow, ist wirklich toll. Wenn mal ein toller Usbeke im Muttental Nasenflöte spielt, melden wir uns. Der englische Akzent war schottisch.
Zusammenfassung: Entweder haben die Menschen in der Vorab-Umfrage gelogen, um nicht als Kulturbanausen da zustehen, oder die Umfrage war von Forsa. Aus Interesse wird keiner kommen. Mitleid und Schuldbewusstsein könnten zur Reise ins Ruhrgebiet motivieren. Für Duisburg bleibt die Nische des Trauertourismus.