
Foto aus dem Privatarchiv von Ribakovs
Alexejs Ribakovs (33) ist ein IT-Manager von Beruf und ein russisch-orthodoxer Priester von Berufung. Er wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtviertel Querenburg. Nun will Ribakovs die Stadt an der Ruhr verlassen, weil er als Priester in seiner Nachbarschaft terrorisiert wird.
Als er am Sonntagabend, den 18. Oktober, in seiner schwarzen Soutane vom Gottesdienst kam, wurde Ribakovs von drei jungen Männern bedrängt. Ein Jugendlicher spuckte ihm mitten ins Gesicht und schlug ihm mehrfach auf die Brust. Die Männer haben Ribakovs als einen "Scheiß-Priester" beschimpft. Als der Geistige sein Handy rausholte, um Polizei zu rufen, flüchteten die Angreifer.
Das war kein Einzelfall. Laut Ribakovs spürt er die Bedrohung von den jungen Nachbarn schon seit etwa vier-fünf Jahren. Unbekannte haben ihn mehrmals auf der Straße beschimpft. Sein Auto wurde mit Erbrochenem und Fäkalien beschmiert.
Das Moskauer Patriarchat hat die Angreifer gerügt. Die Bochumer Polizei hat am Donnerstag einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen türkischstämmigen Jugendlichen (17), den Ribakovs auf der Polizeiwache auf einem Foto wieder erkannt hat.
Ruhrbarone haben mit dem russisch-orthodoxen Priester gesprochen.
Vater Alexejs, haben Sie sich fest entschieden, Bochum zu verlassen?
Ganz fest. Ich habe es mir schon früher einige Male überlegt, etwa als mein Auto beschädigt wurde. Der letzte Angriff brachte das Fass zum Überlaufen. Ich will so schnell wie möglich weg.
Sie wohnen seit zehn Jahren in Bochum…
Ja, und ich habe viele Freunde hier. Es ist schade, diese Stadt zu verlassen. Ich habe Bochum immer gemocht, weil es nicht so groß wie Köln oder Düsseldorf und weil es sehr grün ist. Ich wohne am Rande eines Waldes. Frische Luft ist gut für meine Kinder. Die hiesige Schule ist auch gut… Nun muss meine Tochter die Schule wechseln. Für den Sohn müssen wir auch noch einen Kindergartenplatz im neuen Wohnort finden. Das wird nicht einfach.
Erzbischof Longin von Klin, Vorsteher der Mariä-Obhut-Kirche in Düsseldorf, wo Sie regelmäßig Gottesdienste feiern, hat einen Brief an die Bochumer Stadtregierung geschickt, mit der Bitte, die Täter schnellst möglich zu finden.
Der Erzbischof hat diese Tat sehr ernst wahrgenommen. Er hat mir gesagt, dass der Überfall nicht gegen mich als Person, sondern gegen mich als einen Vertreter der christlichen Religion gerichtet war. Die Jugendlichen haben sich nicht für mein Handy, das silberne Kreuz oder meine Sachen interessiert. Das war nur ein Zeichen im Sinne: „Das ist unser Territorium, geh weg von hier“.
In Deutschland ist die Diskussion über die Integration von Muslimen in letzter Zeit sehr scharf geworden…
Muslime sind ein breiter Begriff. Es gibt Sunniten, Schia, Drusen, Jesiden und andere Glaubensrichtungen im Islam. Man sollte nicht pauschalisieren. Unsere Nachbarn von unten sind aus Irak, sie sind Muslime. Sie haben die Nachricht über den Überfall auf mich mit Trauer aufgenommen. Noch eine Etage tiefer wohnt ein alter türkischer Mann. Wir grüßen uns immer herzlich und haben ganz gute Beziehung. So sind die meisten Menschen. Aber es gibt auch Hohlköpfe. Sie gibt es überall. Es ist traurig, dass sie jetzt unser Viertel unter Kontrolle halten. Diese Leute verstehen nur die „Sprache der Dschungel“. Das einzige Argument für sie: Mit einer schweren Keule über den Kopf. Höfliche Ansprache nehmen sie als Zeichen der Schwäche wahr.
Soll sich die Regierung oder die Gesellschaft mit dem Problem beschäftigen?
Man kann lange Reden über die finanzielle Unterstützung der Integration führen. Ob das was bringt? Ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, meine Steuer für die Integration derjenigen, die sich gar nicht integrieren wollen, zu zahlen. Für diese Leute ist mein Aussehen als Priester ein rotes Tuch. Sie hassen alles, was sie nicht verstehen können. Viel Zeit ist leider verloren gegangen, die man in die Lösung des Problems investieren sollte.
Generell soll die Menschenwürde nicht nur auf Papier, sondern auch in der Realität geschätzt werden. Die erste Frage, die mir die Polizisten gestellt haben, die zum Tatort gekommen sind, war, ob ich die sichtbaren Spuren der Verletzung auf dem Gesicht habe. Nein? Dann ist es nur leichte Körperverletzung und keine einfache Körperverletzung, haben sie gesagt.
Was wollen Sie den Jugendlichen, die sie überfallen haben, sagen?
Ich will ihnen sagen, dass sie mir leid tun. Sie haben keine Zukunft. Ich bin kein Prophet, aber ich kann jetzt schon sagen, wie ihr Leben enden wird. Sie werden wohl wegen einer Überdosierung von Drogen an einem dreckigen Ort sterben. Deswegen tun sie mir sehr leid.






 Das neue Stipendienmodell gibt es in NRW seit einem Semester, aber nicht viele wissen davon.
Das neue Stipendienmodell gibt es in NRW seit einem Semester, aber nicht viele wissen davon.  Etwa 200 Studenten und Schüler, die heute gegen Missstände im Bildungssystem demonstrierten, sind momentan von den Polizisten am Essener Porscheplatz eingekesselt. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Die Polizisten gehen teilweise brutal vor und bedrohen die Protestierenden durch Elektroschocker. Die nicht eingekesselten Studenten zeigen sich solidarisch: Sie organisieren Wasser und Brötchen für die Kommilitonen. Alle eingekesselten werden eine Anzeige bekommen, hat die Polizei verkündet. Dabei verhielten sich die Protestierenden während der Protestaktion friedlich.
Etwa 200 Studenten und Schüler, die heute gegen Missstände im Bildungssystem demonstrierten, sind momentan von den Polizisten am Essener Porscheplatz eingekesselt. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Die Polizisten gehen teilweise brutal vor und bedrohen die Protestierenden durch Elektroschocker. Die nicht eingekesselten Studenten zeigen sich solidarisch: Sie organisieren Wasser und Brötchen für die Kommilitonen. Alle eingekesselten werden eine Anzeige bekommen, hat die Polizei verkündet. Dabei verhielten sich die Protestierenden während der Protestaktion friedlich.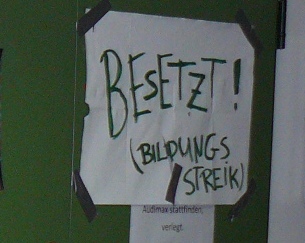 Seit Dienstag Nachmittag besetzen Studierende die beiden größten
Seit Dienstag Nachmittag besetzen Studierende die beiden größten 

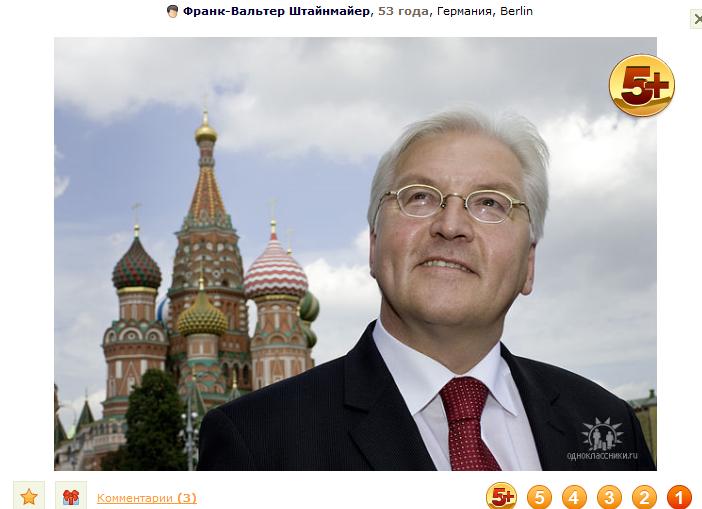 Zumindest für seine Fotos bekommt der SPD-Kanzlerkandidat die besten Noten 5+, ein russischer Äquivalent von 1+. Bei den Kommentaren bezüglich seiner Politik sind sich die Nutzer des populären russischen Sozialnetzwerks
Zumindest für seine Fotos bekommt der SPD-Kanzlerkandidat die besten Noten 5+, ein russischer Äquivalent von 1+. Bei den Kommentaren bezüglich seiner Politik sind sich die Nutzer des populären russischen Sozialnetzwerks 
 Ich liebe das Ruhrgebiet. Hier ist immer was los. Am Freitagabend muss ich mich zwischen einer Oper in Essen, einem Festival in Bochum und einem Filmmusikkonzert in Dortmund entscheiden. Die Freunde überreden mich, das Jubiläumskonzert des Studentenorchesters in Dortmund zu besuchen.
Ich liebe das Ruhrgebiet. Hier ist immer was los. Am Freitagabend muss ich mich zwischen einer Oper in Essen, einem Festival in Bochum und einem Filmmusikkonzert in Dortmund entscheiden. Die Freunde überreden mich, das Jubiläumskonzert des Studentenorchesters in Dortmund zu besuchen.