 Foto: Flickr.com / phlammert
Foto: Flickr.com / phlammert
Der 26. April 1986 war ein sonniger Tag. Meine Mutter, die damals so alt war, wie ich heute, ging mit mir spazieren. Wir lebten in einem kleinen Ort in Weißrussland. Nach dem Regen gab es überall Pfützen. Es blühte Löwenzahn. Ich war gerade ein Jahr alt und genoss meinen ersten Frühling. Ich wusch meine Hände in den glänzenden Pfützen und platschte mit meinen Beinen drin herum. Die Pfützen hatten einen gelben Rand, erinnert sich meine Mutter heute. Damals dachte sie, es sei Blütenstaub vom Löwenzahn. Sie wusste noch nicht, dass seit diesem Tag unser Löwenzahn, unser Wasser und unser Boden vergiftet sind.
Ein paar Tage später gab es eine kurze Information in den sowjetischen Medien: In der Nacht auf den 26. April ist der vierte Block des Atomkraftwerks in Tschernobyl explodiert. Es gebe keinen Grund zur Panik, hieß es, niemand sei betroffen, alles in Ordnung. Es wurde allerdings empfohlen, die Fenster in den Wohnungen zu schließen. Am Tag der Arbeit versammelten sich Menschen in unserer kleinen Stadt Tschausy im Osten Weißrusslands auf dem Lenin-Platz. Es waren die üblichen Feiern. Die Leute waren aufgeregt wegen der Nachricht und wegen des Frühlingsfiebers.
Ich kann mich an diese sonnigen Tage nicht erinnern. Dafür habe ich viele positive Erinnerungen aus meiner Kindheit, die mit Tschernobyl verbunden sind. In der Schule bekamen wir drei Mal am Tag kostenloses Essen. Zum Mittag gab es Suppe, Fleisch oder Fisch mit Beilage und einem Getränk. Manchmal gab es Algen. Das mochten wir aber nicht, obwohl (oder gerade weil) sie wegen des hohen Jod-Gehaltes als besonders gesund galten. Was wir wahnsinnig mochten, war das Obst, das wir jeden Tag zum Mittagessen bekamen. Dies wurde vom Staat und den internationalen Organisationen finanziert. Sie hießen „Hoffnung“ oder „Kinder von Tschernobyl“. Wir, die Kinder von Tschernobyl, waren eigentlich ganz glücklich.
Zum Neujahr gab es regelmäßig Pakete aus dem Westen – die so genannte humanitäre Hilfe. In den Päckchen gab es leckere Schokolade, Bonbons, Kaugummis, Kakao. Manchmal gab es auch Briefe, die in einer Fremdsprache verfasst wurden. Dort stand zum Beispiel: „Hallo! Ich heiße Tom und ich bin 8 Jahre alt. Ich wohne in einem Haus mit Garten in Deutschland. Mein Lieblingsspielzeug ist Teddybär. Schöne Weihnachten!“ Als ich etwas älter wurde, antwortete ich auf einen dieser Briefe. Ich schrieb: „Hallo Tom! Ich heiße Olga. Ich bin 10 Jahre alt. Ich habe einen Bruder. Wir wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich gehe zur Schule und lerne dort Deutsch“. Ich habe keine Antwort bekommen. Trotzdem sagte ich allen, dass ich einen Brieffreund habe.
Die wichtigste Freude der Kinder von Tschernobyl ist mir allerdings entgangen – die Chance, einen Sommer in einer Gastfamilie im Westen zu verbringen. In meiner Klasse gab es 25 Kinder, 22 davon waren im Ausland. Die meisten flogen nach Kanada, aber auch nach Italien, Belgien oder Deutschland. Ich war unter den drei, die nicht im Ausland waren. Meine Mutter wollte das nicht. Sie meinte, es wird mir nicht gut in einer fremden Familie gehen. Ich war ein kränkliches Kind. Sie sagte: „Ich kaufe dir alles selber und wenn du erwachsen bist, gehst du, wohin du willst.“ Ich nahm es ihr übel. Ich war neidisch auf die vollen Koffer vom Spielzeug und Süßigkeiten und auf die unzähligen Fotos mit einem großen Haus und einem Swimming Pool im Hintergrund, die meine Mitschüler aus Kanada mitbrachten.
Meine Cousine war ihrerseits neidisch auf mich. Sie wohnte in einem Ort 50 Kilometer von uns entfernt. Im Unterschied zu Tschausy überstiegen die Messungen dort die Grenzwerte nicht. Offiziell gehörte die Stadt nicht zu den radioaktiv verseuchten Gegenden. Deswegen hatte ihre Bevölkerung keine Tschernobyl-Vergünstigungen. Meine Cousine durfte nicht wie ich für einen Monat im Jahr kostenlos ins Sanatorium in einen „sauberen“ Ort in Weißrussland.
Während dieses Erholungsmonats waren wir Schüler unter uns, weit weg von den Eltern. Wir hatten nur vormittags Unterricht und bekamen keine Hausaufgaben. Dafür gingen wir abends in die Kinderdiskothek oder ins Kino, schrieben einander Liebesbriefe und organisierten Konzerte. Das sind meine besten Erinnerungen an die Schulzeit.
Dank Tschernobyl bekam mein Bruder letztes Jahr einen Platz im Studentenwohnheim in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Die Wohnheimplätze sind rar. Studenten mit einer Behinderung, Waisen oder Jugendliche aus einer anderen „sozialen Kategorie", wie zum Beispiel Leute aus einer radioaktiv verseuchten Gegend, haben Vorrang. Die Miete beträgt 40 Euro im Jahr. Sonst sind die Mietpreise in der Minsk ungefähr so hoch wie die in Berlin.
Radiozäsium, Plutonium und Radiostrontium kann man nicht riechen, sehen oder hören. Ich weiß nicht, ob ich ohne Tschernobyl seltener krank gewesen wäre. Man kann nicht genau nachweisen, ob die sinkende Lebenserwartung der Weißrussen mit Tschernobyl verbunden ist.
Im Kindergarten, den meine Mutter leitet, sind nur drei von 87 Kindern völlig gesund. Der Rest hat eine Krankheit. Irgendeine. Das heißt nicht, dass die Kinder drei Arme oder zwei Köpfe haben. Aber sie haben schlechte Augen, Probleme mit den Nieren und der Schilddrüse oder sind „allgemein kränklich“. Man kann nicht nachweisen, ob das mit dem Atomunfall zu tun hat. Der Staat bezahlt für diese Kinder aber die Hälfte der täglichen Verpflegung im Kindergarten, die ungefähr zwei Euro kostet. Einen Euro zahlen die Eltern.
Meine Mutter hat sich bis jetzt nicht verziehen, dass sie mich damals in den Pfützen hat planschen lassen.

 Ein Autoladen in einem belarussischen Dorf
Ein Autoladen in einem belarussischen Dorf 

.jpg)

 Zettel-Motivation auf Russisch: "Pfeiff auf die Krise"
Zettel-Motivation auf Russisch: "Pfeiff auf die Krise"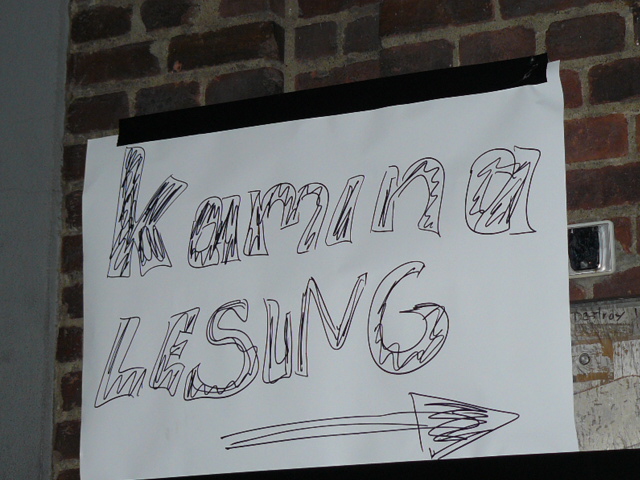 Wladimir Kaminer (41), sieht sich selbst gern “privat als Russe und beruflich als deutscher Schriftsteller“. Die seltsame Beschreibung hat ihren Ursprung in der Geschichte des gebürtigen Sowjetmenschen. 1990
Wladimir Kaminer (41), sieht sich selbst gern “privat als Russe und beruflich als deutscher Schriftsteller“. Die seltsame Beschreibung hat ihren Ursprung in der Geschichte des gebürtigen Sowjetmenschen. 1990 
