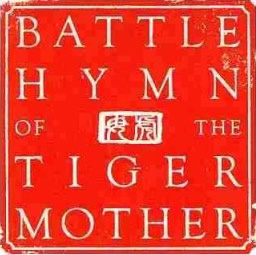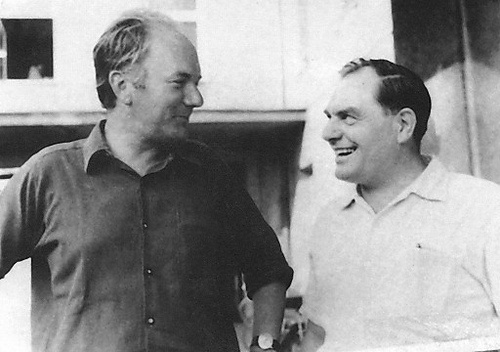Heute wäre Thomas Bernhard 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass zeigt der TV-Sender TW1 die Themenwoche „80 Jahre Thomas Bernhard“. Im Rahmen dieser Reihe kommt auch Bernhards langjähriger „Lebensmensch“ Karl Ignaz Hennetmair zu Wort, mit dem ich kürzlich über seine Freundschaft zu dem österreichischen Autor, dessen Wutausbrüche und den „Märchenonkel“ Marcel Reich-Ranic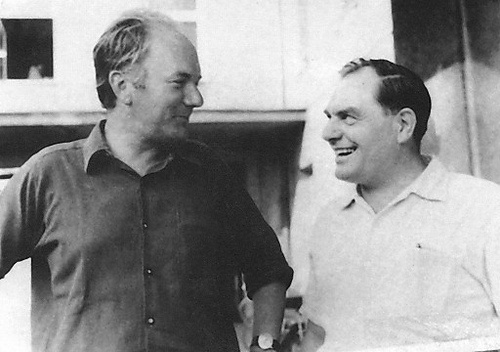 ki sprach. Naturgemäß ist es ein nicht ganz gewöhnliches Gespräch geworden. Gleich zu Beginn fährt mir Hennetmair, ganz im Sinne des Übertreibungskünstler Thomas Bernhard, „in die Parade“ und lässt sich in unvergleichlicher Art und Weise über Österreich aus.
ki sprach. Naturgemäß ist es ein nicht ganz gewöhnliches Gespräch geworden. Gleich zu Beginn fährt mir Hennetmair, ganz im Sinne des Übertreibungskünstler Thomas Bernhard, „in die Parade“ und lässt sich in unvergleichlicher Art und Weise über Österreich aus.
Herr Hennetmair, lassen Sie uns über Thomas Bernhard reden. Sie waren…
… verzeihen Sie, dass ich Ihnen gleich zu Beginn in die Parade fahre, aber es ist nichts weniger als eine unglaubliche Perversität, dass das österreichische Feuilleton, das sich angesichts seiner durch und durch primitiven Berichterstattung schämen sollte, sich als solches zu bezeichnen, heuer nur mehr über den grässlichen Peter Handke oder die anderen scheußlich einfallslosen, vom Staat gleichwohl hoch alimentierten sogenannten Schriftsteller berichtet, und nur alle paar Jahre, wenn denn mal ein runder Geburtstag ansteht, an einen Jahrhundertschriftsteller wie der Thomas es war, erinnert.
Nun, ehrlich gesagt habe ich mit dem österreichischen Feuilleton nicht das Geringste am Hut.
Seien Sie froh! Die Zeitungen in Österreich sind ganz und gar stumpfsinnig, ja geradezu gemeingefährlich. So etwas gibt es nur hier, nirgends sonst.
„Niemand ist perfekt, außer Thomas Bernhard wenn er schimpft“, schrieb Siegfried Unseld seinerzeit. Offenkundig hat er sich geirrt. Sie stehen Bernhards Schimpfkanonaden in nichts nach.
Das mag sein. Wenn man sich jahrzehntelang mit Thomas Bernhards Leben und Werk auseinandersetzt, hat das naturgemäß Folgen.
Man läuft Gefahr, seine von Misanthropie und Hass auf alles Österreichische geprägten Satzkaskaden zu übernehmen? Das klingt zugegebenermaßen beängstigend.
Das ist der Preis, den man für die Lektüre seiner Bücher zahlen muss. Und fürs Protokoll: Die österreichische Presse ist bekannt für ihre Niederträchtigkeit. Das wissen alle – mit Ausnahme der Österreicher!
Wagen wir einen zweiten Versuch, Herr Hennetmair. Sie waren einer der wenigen Menschen, deren Nähe Thomas Bernhard zuließ. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Schauen Sie, der Thomas hat die sogenannten Intellektuellen wegen ihres affektierten Auftretens gehasst. Die Landbewohner wiederum verachtete er wegen ihres Stumpfsinns. Ich hingegen war weder das eine noch das andere. Als früherer Ferkelhändler und später dann als Realitätenvermittler stand ich irgendwie dazwischen. Ich glaube, er hat schlicht und einfach meine ehrliche, unverstellte Art gemocht, die in seinem Milieu, dem Kunstbetrieb, nicht existierte.
Was schätzten Sie an dieser Freundschaft?
Wenn man in der tiefsten österreichischen Provinz einen Geistesmenschen wie ihn trifft, ist das ein Glücksfall. In ihm fand ich inmitten dieser ganzen Geschmacklosigkeit einen Gesprächspartner. Die Welt wäre ja eine ganz und gar sinnlose, wenn es nicht Menschen wie Thomas geben würde, die uns mit ihrem Geist von unserer lächerlichen Existenz ablenken.
In seinem Werk reflektierte Thomas Bernhard geradezu monomanisch Krankheit und Tod. Wie müssen wir uns vor diesem Hintergrund den privaten Bernhard vorstellen?
Wenn er arbeiten konnte, schrieb er sich die Verzweiflung vom Leib, so dass wir abends ganz entspannt Krimis oder Sportschau schauen konnten. Der Thomas war dann ein sehr heiterer Mensch. Ungemütlich wurde er nur, wenn er nichts zu Papier brachte.
Was genau bedeutet „ungemütlich“?
Er brauchte immer ein Ventil, um Druck abzulassen. Wenn er nicht schreiben konnte, gingen wir als Ausgleich kilometerlang spazieren; da hat er dann über den Tod monologisiert. Monologe, die er anschließend Wort für Wort in seinen Büchern wiederholt hat, wie ich später feststellte.
Haben Sie diese Spaziergänge mit der Zeit nicht gelangweilt?
Es heißt, er hätte immer wieder ein und dasselbe Buch geschrieben – ein Riesenschmarrn! Wie bei seinen Büchern geriet man unweigerlich in einen Sog, wenn der Thomas Vorträge hielt. Minetti hat mit Recht gesagt, dass er in Bernhards Sätzen zu Hause ist. So ist es auch bei mir.
In Ihrem 2001 publizierten Tagebuch „Ein Jahr mit Thomas Bernhard“ beschreiben Sie, wie schwierig es war, nicht seinen Zorn zu erregen. War es eine Freundschaft auf Augenhöhe?
Das war es uneingeschränkt. Ich habe ihm immer geradeheraus meine Meinung gesagt. Alles andere hätte er auch nicht akzeptiert. Dessen ungeachtet war die Freundschaft zu ihm eine ungeheure Herausforderung. Es glich meinerseits gelegentlich einem Tanz auf dem Vulkan.
Inwiefern?
An einem Tag war er der liebste Mensch auf Erden. Dann wiederum glich er dem Bruscon aus seinem „Theatermacher“ und ließ an nichts und niemanden ein gutes Haar. Diese Wut zu ertragen konnte anstrengend sein. Bei aller Liebe, Thomas war immer auch ein Scheusal sondergleichen.
1975 kam es zwischen Ihnen beiden zum Bruch. Haben Sie es jemals bereut, sich mit ihm eingelassen zu haben?
Niemals! Mir war immer klar, dass es schwieriger ist, mit einem Geistesmenschen befreundet zu sein als mit einem Idioten. Dem Idioten können Sie ja alles sagen, ohne dass er es versteht. Gegenüber dem Geistesmenschen muss man aber stets acht geben. Der Künstler ist naturgemäß feinfühliger als der Fleischhauer.
Warum sprechen Sie bis heute nicht über den Grund des Bruchs?
Na, weil ich finde, dass das nur den Thomas und mich etwas angeht. Er hat eben andere Menschen oft ohne jeden Grund beschuldigt. Und da habe ich ihm jedes Mal gesagt: „Ich schau dich lebenslänglich nicht mehr an, wenn du mich so beschuldigst.“ Ich habe nur Wort gehalten.
Um welche Beschuldigung handelte es sich genau?
Guter Versuch, aber schon allein dem Thomas zuliebe sage ich kein Sterbenswort. Das nehme ich mit ins Grab.
Bernhards Biographin Gitta Honegger schrieb, dass er homosexuell gewesen sei und dass das bei Ihrer Entzweiung womöglich eine Rolle spielte. Wie stehen Sie dazu?
Na, das ist doch wirklich ein ganz großer Schmarrn. Ich weiß von mindestens einem Fall, wo er mit einer Dame weggegangen ist und bei ihr übernachtet hat. Man darf halt nicht alles glauben, was die Leute zwischen Buchdeckel klatschen. Jedes Jahr ein neues infames Gerücht. Was die Honegger heute, war der Marcel Reich-Ranicki früher.
Sie spielen darauf an, dass Reich-Ranicki einmal schrieb, Bernhard sei infolge seines lebenslangen Lungenleidens impotent gewesen.
Ja, eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen. Jeder weiß, dass Reich-Ranicki gerne den Märchenonkel gibt und sich Geschichten ausdenkt, weil ihm die Wirklichkeit zu fad ist. Aber wie ich wird der ja bald enteignet, dann hat es sich ohnehin. Dann spielt es keine Rolle mehr, wer was sagt.
Enteignet? Wie meinen Sie das?
Na, Sie sind noch jung, bei Ihnen dauert es hoffentlich noch eine Weile. Aber früher oder später werden wir in dieses dunkle Nichts unter unser aller Füssen gestoßen. Das ist ja die eigentliche Gemeinheit im Leben. Dagegen werde ich wie Thomas Bernhard bis zum Schluss aufbegehren.
Das Interview erschien, in anderer Version, zuerst auf Cicero Online.