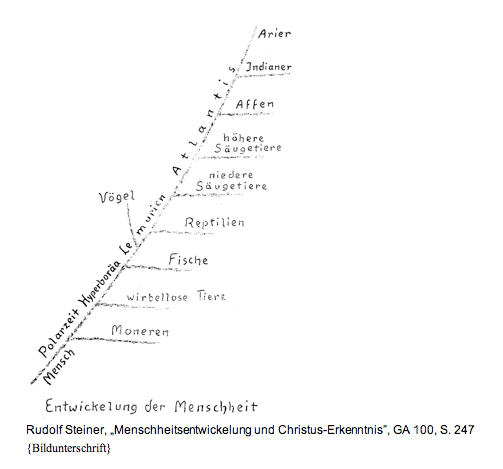
Nach dem „PISA-Schock“ suchen immer mehr Eltern nach einer Alternative zur öffentlichen Schule. Oft fällt ihre Wahl auf eine der 213 anthroposophisch geprägten Waldorfschulen in Deutschland.
Die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart als Betriebsschule der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik gegründet. Die pädagogische Leitung lag bei Rudolf Steiner. Die von ihm entwickelte Weltanschauung „Anthroposophie“ ist bis heute verbindliche Grundlage des Unterrichts jeder Waldorfschule.
Nach anthroposophischem Selbstverständnis hatte Rudolf Steiner unmittelbaren Zugang zur „Geistigen Welt“, sprich: Steiner hatte hellseherische Fähigkeiten. Die Anthroposophie schöpft damit aus esoterischen und okkulten Quellen. Rudolf Steiner (1861–1925) promovierte 1891 in Philosophie; die 1894 versuchte Habilitation scheiterte. Um 1900 kam er in Kontakt mit Helena Petrovna Blavatskys esoterischer „Theosophie“. Von 1902 bis 1912 leitete Steiner die deutsche Sektion der „Theosophischen Gesellschaft“, die er 1912/13 abspaltete und unter dem Namen „Anthroposophie“ neu gründete. Bis heute ist Rudolf Steiner die unangefochtene Autorität der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Wie weit die Verehrung geht, mag man am Umfang der Steiner-Gesamtausgabe ermessen: Sie hat zurzeit 354 Bände. Wir sprachen mit Andreas Lichte, einem ausgebildeten Waldorflehrer und heutigem Kritiker der Waldorfbewegung.
Ruhrbarone: Herr Lichte, Sie haben eine Fortbildung zum Waldorflehrer abgeschlossen aber trotz Job-Angebotes darauf verzichtet, in der wunderbaren Waldorfwelt zu arbeiten – warum?
Andreas Lichte: Als ich mich entschloss, Kunst- und Werklehrer in der Waldorfschule zu werden, wusste ich noch nicht, dass die wichtigste Qualifikation eines Waldorflehrers darin besteht, Rudolf Steiner (den Gründer der Waldorfschulen und der Anthroposophie) als absolute Autorität zu verehren, z.B. so etwas:
„Der Mensch steht der Außenwelt gegenüber. Das Geistig-Seelische strebt danach, ihn fortwährend aufzusaugen. Daher blättern wir außen fortwährend ab, schuppen ab. Und wenn der Geist nicht stark genug ist, müssen wir uns Stücke, wie zum Beispiel die Fingernägel, abschneiden, weil der Geist sie, von außen kommend, saugend zerstören will.“
Was soll das sein? Der Heilige Rudolf, Schutzpatron der Maniküren?
Ich bitte schon um ein wenig mehr Respekt vor der Waldorfpädagogik! Das ist ein Zitat aus Steiners „Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik“ [GA 293, S. 93f]. Wie der Titel dieses in jedem Waldorfseminar gelesenen Standardwerkes schon sagt, ist das die Basis der Arbeit des Waldorflehrers …
Wir gehen mal davon aus, dass Sie das bewusst aus dem Zusammenhang gerissen zitieren …
Sind Sie bei Anthroposophen in die Schule gegangen? Anthroposophen mögen es gar nicht, wenn öffentlich wird, was Rudolf Steiner wirklich sagte, dann heisst es jedes mal: „Aus dem Zusammenhang gerissen!“. Ist es aber nicht. Es wird alles noch viel, viel überzeugender, wenn Sie auch den Kontext kennen, lesen Sie doch bitte selber nach. Hier
Solch einen Wahnsinn müssen Waldorflehrer als Wahrheit akzeptieren?
Falls Sie erwägen sollten, Waldorflehrer zu werden, sollten Sie schon ein wenig flexibel sein … wie sagte Michael Handtmann, Leiter des „Seminar für Waldorfpädagogik Berlin“ bei meinem Vorstellungsgespräch: „Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie Anthroposoph werden … Sie sollten schon ein wenig Offenheit für weltanschauliche Fragen mitbringen, mehr nicht …“
Im Ernst: Worin besteht denn nun die Qualifikation des Waldorflehrers?
Vielleicht sollten wir die Waldorfschüler fragen? Deren Spruch zur Sache:
„Und reicht es nicht zum Strassenkehrer, dann werd’ ich eben Waldorflehrer!“
Es gibt Straßen die es in sich haben.
Kennen Sie Prof. Hermann Avenarius ? Er ist einer der renommiertesten Deutschen Schulrechtler. Er stellte kürzlich in „Frontal 21“, ZDF, fest, dass die Ausbildung der Waldorflehrer ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist, da die im GG genannten Mindestanforderungen nicht erfüllt werden – GG, Artikel 7, Absatz 4, Satz 3: "Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen (…) in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen …"
Die Waldorflehrer sind also schlechter qualifiziert als Lehrer an öffentlichen Schulen?
Lehrer, die an öffentlichen Schulen unterrichten dürfen, könnten jederzeit an einer Waldorfschule arbeiten. Umgekehrt gilt dies nicht: Die Ausbildung an den anthroposophischen Waldorfseminaren wird nicht für den öffentlichen Schuldienst anerkannt. Deswegen sind Waldorflehrer auch vielfach völlig unkritisch: Wer sich in der Waldorfschule unbeliebt macht, dadurch seinen Arbeitsplatz verliert, steht vor dem Nichts, hat keine berufliche Alternative.
Wo sollten Waldorflehrer denn kritischer sein?
„Steiner“? Haben wir den Namen schon einmal gehört? Alles, was in der „pädagogischen Schicksalsgemeinschaft“ Waldorfschule passiert, basiert letztlich auf Steiner, auch wenn das von den Verantwortlichen routinemässig geleugnet wird – man möchte ja keine möglichen Kunden abschrecken …
Werden die Eltern über den weltanschaulichen Hintergrund der Waldorfschulen aufgeklärt?
Waren Sie schon einmal auf einem Eltern-Informationsabend einer Waldorfschule? Ich schon. Da heisst es: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“. Und: „Anthroposophie? Was soll das sein?“ Es wird abgestritten, dass die Anthroposophie auch nur die geringste Rolle im Unterricht spielen könnte.
Offiziell heisst es ja, dass nur die Pädagogik auf Rudolf Steiner beruhe, die Anthroposophie selber aber nicht unterrichtet werde.
Mir wurde nach dem Besuch einer Informations-Veranstaltung einer sich modern und liberal gebenden Waldorfschule ein Geschichts-Epochenheft zugespielt. Der Inhalt: Das anthroposophische Geschichtsverständnis nach Rudolf Steiner, kindgerecht aufbereitet. Inklusive Atlantis.
Sie meinen „Atlantis“?
„Atlantis“ fällt natürlich sofort ins Auge, weil das Heft damit beginnt und der Stoff so exotisch ist.
Was haben Sie denn daran auszusetzen, dass griechische Mythologie – der Atlantismythos Platons – in der Schule unterrichtet wird?
Platon? Es ist Steiner für Kinder! Ich habe ein Geschichts-Epochenheft mit Steiner verglichen, es ist eine fast wörtliche Wiedergabe von Steiners Neo-Atlantis-Mythos. Danach leben wir alle im „Fünften Nachatlantischen Zeitalter“.
Ist uns neu.
Atlantis spielt eine entscheidende Rolle im anthroposophischen Geschichtsverständnis: Atlantis ist für den Anthroposophen eine historische Tatsache. Im „Atlantischen Zeitalter“ werden die Voraussetzungen für die heutige Menschheit geschaffen: Die Rassen entstehen und es beginnt eine fiktive Völkerwanderung, angeführt von „Manu“, dem „Menschheitsführer“ …
Wohin geht denn die Reise?
Lichte: Kurz gesagt: „Vom Menschen zum Arier“ (siehe Abbildung oben).
Der Mensch steht am Anfang der Evolution?
Das ist Anthroposophie …
Das ist Humbug!
Sie sagen es! Und das ist für mich das eigentlich Erstaunliche: Wieso bemerken die Eltern nicht, womit ihre Kinder in der Waldorfschule Zeit verschwenden? Schaut denn niemand in die Hefte? Systematische Kindesvernachlässigung? Zu verstehen, dass Atlantis und die sich daran anschliessenden „Kulturepochen“ Original Steiner sind, ist ja eine Sache, aber dass das krudeste Esoterik ist, sollte jedem doch sofort klar sein.
Sie sagten vorhin, dass in Atlantis „die Rassen entstehen“ …
Und nach anthroposophischer Auffassung bis mindestens zum Jahre 3573 bestehen bleiben, dann endet die „Fünfte Nachatlantische Kulturepoche“. „Rassen“ wie „Rassismus“. Das ist nicht meine Privatmeinung, sondern wurde von einer Deutschen Bundesbehörde, der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) festgestellt, in ihrer Entscheidung zu zwei Büchern Steiners, Zitat: „Der Inhalt des Buches ist nach Ansicht des 12er-Gremiums in Teilen als zum Rassenhass anreizend bzw. als Rassen diskriminierend anzusehen.”
Die BPjM nahm eine juristische Bewertung vor, sie konnte nur Textstellen beanstanden, die eindeutig ihren juristischen Kriterien entsprachen. Auch beurteilte sie nicht Steiners Gesamtwerk. Das tut der Historiker Helmut Zander in seinem preisgekrönten Monumental-Werk „Anthroposophie in Deutschland“, Zitat: „Steiner ordnete die Rassen einer Fortschrittsgeschichte zu, in der beispielsweise heutige Indianer als »degenerierte Menschenrasse« im »Hinsterben« (GA 105, 106, 107 [1908]) oder schwarze Afrikaner als defiziente Spezies der Menschen- und Bewusstseinsentwicklung, als »degenerierte«, »zurückgebliebene« Rasse (ebd., 106) erschienen. Umgekehrt habe die weisse Rasse »das Persönlichkeitsgefühl am stärksten ausgebildet« (GA 107, 288 [1909]). Dies sind nur Kernsätze einer Rassentheorie, die Steiner 1904 erstmals formulierte, um sie 1910 in einem komplexen System und in zunehmender Abgrenzung zu theosophischen Positionen auszufalten. Mit seinem Ausstieg aus der Theosophie hat er diese Vorstellungen keinesfalls über Bord geworfen, sondern sie 1923 nochmals in Vortragen vor Arbeitern des Goetheanum in vergröberter, »popularisierter« Form wiederholt, aber ohne Revision im inhaltlichen Bestand. Die weisse war nun »die zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse« (GA 349, 67 [1923]). (…) Steiner formulierte mit seinem theosophischen Sozialdarwinismus eine Ethnologie, in der die Rede von »degenerierten«, »zurückgebliebenen« oder »zukünftigen« Rassen keine »Unfälle«, sondern das Ergebnis einer konsequent durchgedachten Evolutionslehre waren. Ich sehe im Gegensatz zu vielen Anthroposophen keine Möglichkeit, diese Konsequenz zu bestreiten.“
„Rassentheorie“ passt nicht zum Image der Waldörfler
Noch böser aber die Reaktion der Anthroposophie, die in ihrer Leugnung von Steiners Rassismus ihrem Ruf als „Sekte“ mehr als gerecht wird. Da setzt man sich auch ganz locker über Vereinbarungen mit einer Deutschen Bundesbehörde hinweg.
Wie akut ist denn der Rassismus in der Waldorfschule?
Akut kann er IN der Waldorfschule gar nicht werden, da Waldorfschulen weitgehend „ausländerfreie Zonen“ sind.
Waldorfschulen betonen doch immer wieder ihr soziales Engagement.
In Deutschen Waldorfschulen gibt es kaum Kinder mit „Migrationshintergrund“, oder Kinder aus „sozial benachteiligtem“ Milieu. Das ist auch der INOFFIZIELLE Grund für ihren Erfolg: Bei der privilegierten Klientel überrascht es nicht, dass die Abiturquote nicht so schlecht ist. Auch können finanziell besser gestellte Eltern den umfangreichen Nachhilfeunterricht bezahlen, der nötig ist, um die Defizite der Schule auszugleichen.
Wenn die Waldorfschulen so schlecht sind, wie Sie sie darstellen – unqualifizierte Lehrer, krude Esoterik – warum entscheiden sich dann so viele Eltern für sie?
WEIL sie ausländerfreie Zonen sind. Das sagt Ihnen natürlich niemand sofort, da braucht es schon ein wenig Fingerspitzengefühl, um nach stundenlangem Diskutieren die Antwort zu bekommen: „Ich wohne in Kreuzberg. Da schicke ich mein Kind doch nicht in eine Schule mit hohem Ausländeranteil …“
Gibt es vielleicht auch noch andere Gründe?
Attraktiv könnte für Eltern auch sein, dass es an Waldorfschulen leichter ist, einen staatlich anerkannten Abschluss zu erlangen. So wie die Ausbildung der Waldorflehrer ein bisher ungeahndeter Verstoß gegen das Grundgesetz ist, so gibt es zahlreiche Sonderregelungen für die Abschlüsse an Waldorfschulen, die einer strengen juristischen Überprüfung wohl kaum standhalten dürften. Schauen Sie sich beispielsweise die „Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen der Sekundarstufe I an Waldorfschulen“ des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 2008 an – ein „Lex Waldorf“.
Wie erklären Sie es sich, dass den Waldorfschulen von der Politik all diese Privilegien eingeräumt werden?
Das fragen Sie am besten selber NRW Kultusministerin Dr. Barbara Sommer. Ich kann Ihnen von der Berliner Schulaufsicht berichten, dass auf unzählige Anfragen und Beschwerden zur Waldorfpädagogik nur mit nichts sagenden Standard-Briefen „geantwortet“ wurde. Ich verabschiede mich mal mit einem Auszug aus dem Brief eines Vaters, der an Landesschulrat Hans-Jürgen Pokall ging – nicht an „Dr. Sommer“, wie man vielleicht zu Recht vermuten könnte …:
„(…) Es stellt sich heraus, dass Steiner auch noch Visionen zum Wesen der Sexualität hat. Ich möchte mir gar nicht erst vorstellen, was für gravierende Folgen es für Heranwachsende hätte, wenn sie auch nur in kleinsten Dosen mit Steiners »Sexualkunde« in Berührung kämen, Zitat Steiner:
»Ursprünglich war auch der Mensch ein ätherisches Wesen von pflanzlicher Substanz. Damals hatte der Mensch diejenige stoffliche Natur, welche heute die Pflanze noch besitzt. Hätte der Mensch nicht die pflanzliche Substanz zum Fleisch umgewandelt, so wäre er keusch und rein geblieben wie die Pflanze. (…)
Die Fortpflanzungsorgane haben am längsten ihren pflanzlichen Charakter bewahrt. Alte Sagen und Mythen berichten uns noch von Hermaphroditen (…).
Manche glauben, das Feigenblatt, das die ersten Menschen im Paradies gehabt haben, sei ein Ausdruck der Scham. Nein, in dieser Erzählung hat sich die Erinnerung daran bewahrt, daß die Menschen an Stelle der fleischlichen Fortpflanzungsorgane solche pflanzlicher Natur gehabt haben (…).
Der Mensch wird nicht auf seiner jetzigen Stufe stehenbleiben. Wie er von der reinen Keuschheit der Pflanze in die Sinnlichkeit der Begierdenwelt hinabgestiegen ist, so wird er aus dieser wieder heraufsteigen mit reiner geläuterter Substanz zum keuschen Zustande.(…)
Wieso wird eine Schule staatlich gefördert, die sich ausdrücklich auf Rudolf Steiner beruft – einen prima-facie an einer psychischen Störung leidenden Menschen?"
Zum Interviewpartner: Andreas Lichte ist ausgebildeter Waldorflehrer und Grafiker, lebt in Berlin. Er ist Autor kritischer Artikel zur Waldorfpädagogik und Anthroposophie. Er erstellte für die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) ein Gutachten zur Indizierung zweier Werke Rudolf Steiners, die fortan nur noch in kommentierter Form erscheinen dürfen.




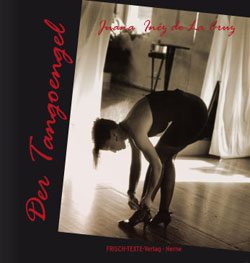
 Foto: Flickr.com /
Foto: Flickr.com /  Beim auspacken fiel mir die sehr elegante Schutzhülle auf. Richtig schick. Das Beste zum Angeben im Zug oder im Flugzeug. Edel, schlicht, Leder. Liegt in der Hand, weich, wie ein Pfirsich. Toll.
Beim auspacken fiel mir die sehr elegante Schutzhülle auf. Richtig schick. Das Beste zum Angeben im Zug oder im Flugzeug. Edel, schlicht, Leder. Liegt in der Hand, weich, wie ein Pfirsich. Toll. Ich könnte jetzt für 20 Euro oder so einen neuen Roman runterladen. Durchaus guten Stoff. Das geht. Aber für einen Test ist mir das zu teuer. Vor allem weil ich das Gerät nach einer Woche wieder abgebe. Und danach kann ich mir den für 20 Euro angeschafften Roman nicht in mein Regal stellen. Ich kann ihn auch nicht meiner Frau geben, oder einem Kumpel schenken. Ich kann ihn auch nicht verleihen, einpacken oder unter ein zu kurzes Stuhlbein schieben. Ich kann nicht mal damit ein Feuer anmachen.
Ich könnte jetzt für 20 Euro oder so einen neuen Roman runterladen. Durchaus guten Stoff. Das geht. Aber für einen Test ist mir das zu teuer. Vor allem weil ich das Gerät nach einer Woche wieder abgebe. Und danach kann ich mir den für 20 Euro angeschafften Roman nicht in mein Regal stellen. Ich kann ihn auch nicht meiner Frau geben, oder einem Kumpel schenken. Ich kann ihn auch nicht verleihen, einpacken oder unter ein zu kurzes Stuhlbein schieben. Ich kann nicht mal damit ein Feuer anmachen. Und dann ist der Akku leer.
Und dann ist der Akku leer.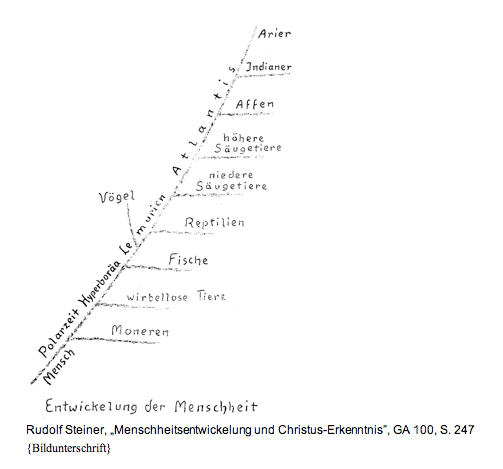
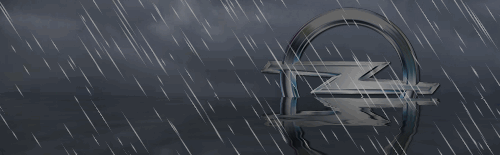
 Wegen eines kleinen Aliens mit einer Torte aus dem Spiel Super Bomberman auf einem Anti-Nazi-Demo-Aufruf wurde der Betreiber der Webseite Bo-Alternativ, Martin Budich, wegen des Aufrufs zur schweren und gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, und heute kam es zum Prozess. Er endete im Freispruch. Die Torte war ne Torte.
Wegen eines kleinen Aliens mit einer Torte aus dem Spiel Super Bomberman auf einem Anti-Nazi-Demo-Aufruf wurde der Betreiber der Webseite Bo-Alternativ, Martin Budich, wegen des Aufrufs zur schweren und gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, und heute kam es zum Prozess. Er endete im Freispruch. Die Torte war ne Torte.
