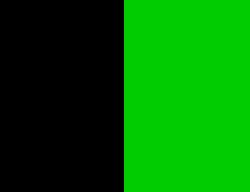Vor ein paar Tagen wurde hier dazu aufgerufen, eigene Bilder und Texte zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 einzusenden. Angesichts der Katastrophe von Duisburg fanden das einige Kommentatoren nicht richtig. Wenn schon die ganze Veranstaltung als ganzes nicht abgebrochen worden ist, dann sollte man wenigstens nun darüber schweigen, nach Duisburg könne es einfach keine Geschichten mehr über die Kulturhauptstadt geben.
Vor ein paar Tagen wurde hier dazu aufgerufen, eigene Bilder und Texte zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 einzusenden. Angesichts der Katastrophe von Duisburg fanden das einige Kommentatoren nicht richtig. Wenn schon die ganze Veranstaltung als ganzes nicht abgebrochen worden ist, dann sollte man wenigstens nun darüber schweigen, nach Duisburg könne es einfach keine Geschichten mehr über die Kulturhauptstadt geben.
Ich bin anderer Ansicht. Selbst wenn man die Loveparade als Zäsur begreift, sind da immer noch die Eindrücke und Erinnerungen, die bis zum 24. Juli gesammelt worden sind. Egal wie einschneidend die Katastrophe gewesen sein mag, diese Sachen lassen sich nicht einfach löschen oder mit einem Tabu belegen. Nach meinem Empfinden geht es auch gar nicht darum zu zeigen, daß hier alles Trallafitti gewesen sei, irgendwie getreu dem Motto: „Mein schönstes Kulturhauptstadterlebnis“, analog zum Aufsatz in der ersten Deutschstunde nach den Sommerferien. Eher im Gegenteil.
Ich mach dann man den Anfang, quasi als letzten Aufruf an alle, die noch etwas einsenden wollen… Also, last call, letzte Runde…
Es gab eine Aktion, die fand ich, nachdem ich sie endlich bemerkte, partiell schön und generell ziemlich daneben. Die Ruhr Figur.
Irgendwann komm ich an diesem niedlichen Haus mit gepfegtem Vorgarten vorbei und sehe dort diesen Spinöppel in der Sonne glänzen. Extravagant, Edelstahl, dachte ich, passte aber irgendwie gut zum Stil des Hauses, der ist nicht gerade expressionistisch, aber handwerklich schön vermauerter Ziegel, nix NF-Format, sondern irgendetwas älteres, schmaler, Hamburg vielleicht, solide! Kriegt so heutzutage kaum noch ein Maurer hin. Ich komme oft an diesem Haus vorbei, meistens freue ich mich wenn ich es sehe. Auf dem Rückweg nach diesem ersten Treffen mit dem Männeken gehe mal näher an den Zaun heran und lese auf dem Betonsockel: „Ruhr-Figur… blablarharblablabla“… Muss ich mir merken, daheim mal googleln…
Gesagt, getan. Ruhr-Figur war/ist ein Projekt des Dortmunder Künstlers Wolfgang Schmidt. 100 Figuren sollten so über das Ruhrgebiet verteilt werden, daß, aus der Luft betrachtet, sich wiederum das Bild der Figur ergeben sollte. Schön gedacht, aber schon damals fragte ich mich, ob den Betreibern die Symbolik der ganzen Nummer eigentlich klar ist… Auf viel zu dünnen Beinchen steht das Ruhrgebiet auf Duisburg. Der Kopf ist in Dortmund und Bochum… tscha, Bochum leidet unter Hodenhochstand, da ist dann alles smooth as a Ken doll. Es fällt mir schwer mir vorzustellen, daß die Verantwortlichen in den Städten damit sonderlich zufrieden gewesen sein sollen. Symbolische Symbolik, Symbolik zum Quadrat.
Was soll’s, es gab ja Sponsoren, die die Nummer finanziert haben, angeblich 5000 Euro pro Statuette. Für mich gab es bei der Aktion ein paar Unstimmigkeiten. In Sichtweite zueinander sollten die Figuren stehen… Hätte man tatsächlich, wie von den Initiatoren gewünscht, google earth bemüht, um die Standorte zu erkunden, man hätte bemerkt, daß sie doch ein paar Zentimeter mehr auseinanderstehen als die erklärten 400-600 Meter. Aber vielleicht ist die Frage der Sichtweite auch nur eine Frage nach der Stärke des Fernglases, Sichtweite als solche ist total überbewertet. Ich bin ja auch kurzsichtig, da darf man das alles nicht ganz so eng sehen, ausserdem stehen im Ruhrgebiet ja noch nicht einmal die Kirchtürme in Sichtweite zueinander…
Trotzdem, schön war es irgendwie ja schon, die Idee, die ganze Installation, die Figur im Vorgarten, aber was davon ist nachhaltig, schließlich war das ja eines der Themen und Ziele der Kulturhauptstadt? Um es kurz zu machen: wenig!
Nach Ablauf des Jahres sollten die Figuren demontiert und den jeweiligen Sponsoren übergeben werden, damit diese sie in den eigenen Vorgarten oder sonstwohin stellen können. Ist auch so geschehen. Keine Ahnung, wer diese Sponsoren so alles waren und wo sie die Statuetten aufstellen. Aus der Luft betrachtet dürfte das neue Bild der Standorte nun jedenfalls eher dem komplizierten Schnittmuster für einen Kilt oder eine Hemdbrust mit Rüschen entsprechen… Was dem Charakter des Ruhrgebiets wesentlich näherkommen dürfte als die Grundidee. Was bleibt ist für mich jedenfalls wenig mehr als ein…

… Loch im Vorgarten, irgendwie kubiksymbolisch…
 Am Samstag findet die erste ruhrgebietsweite Demonstration gegen die Nutzung der Atomkraft in Essen statt.
Am Samstag findet die erste ruhrgebietsweite Demonstration gegen die Nutzung der Atomkraft in Essen statt.