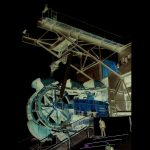Der Ruhrpilot
 NRW: Gefährliches Spiel mit Neuwahlen…Welt
NRW: Gefährliches Spiel mit Neuwahlen…Welt
Japan: Fukushima-Lageübersicht der IAEA…Frontmotor
Libyen: Luftschlag stoppte Panzertreck vor Bengasi…Spiegel
NRW II: Ohne Bewegungsspielraum…Post von Horn
NRW III: Ingo Wolf attackiert „Rot-Rot-Grün“…Kölnische Rundschau
NRW IV: Auf den Spuren des jüdischen Lebens…Kölnische Rundschau
Ruhrgebiet: Wiedersehen mit Emscherkunst 2013…Schmidts Katze
Bochum: Große Kundgebung in der Innenstadt…Der Westen
Bochum II: Großdemo gegen Atomkraft…Ruhr Nachrichten
Dortmund: 10 Jahre DJ Firestarter…Ruhr Nachrichten
Dortmund II: Bewegende Momente im Westfalenstadion…Pottblog
Dortmund III: „Brückstraße ist ein besonderes Biotop“…Der Westen
Duisburg: Rot-rot-grünen Spuk schnell beenden…Der Westen
Gelsenkirchen: Anti-Atom Flashmob…Gelsenkirchen Blog
Essen: Equitana endet mit leichtem Minus…Der Westen
Umland: Nazis scheitern knapp an 5 Prozent…taz
Umland II: California here I come I…Zoom
Über 1500 auf Anti-Atom Kundgebung in Bochum
 Am Tag neun der Reaktorkatastrophe fand in Bochum erneut eine Kundgebung gegen Atomkraft statt. Über 1500 Menschen versammelten sich auf dem Rathausplatz.
Am Tag neun der Reaktorkatastrophe fand in Bochum erneut eine Kundgebung gegen Atomkraft statt. Über 1500 Menschen versammelten sich auf dem Rathausplatz.
Über 1500 Menschen demonstrierten heute Mittag ab 13.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Bochum gegen Atomkraft und gedachten der Opfer der Reaktorkatastrophe in Japan. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten die Gewerkschaften.
Es war eine ruhige, würdige Veranstaltungen. Störungen, wie von der MLPD bei der Mahnwache am vergangenen Montag, gab es nicht. Ohnehin hielten sich die Parteien zurück. Anti-Atom Fahnen und selbstgemalte Transparente bestimmten das Bild.
Bochum Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD) forderte in einer Rede die Bundesregierung auf, „eher schneller als langsamer“ aus der Atomkraft auszusteigen. Sie erinnerte an die 70 in Bochum lebenden Japaner und die Partnerschaft der Ruhr Universität mit der Hochschule in Fukushima.
Heute, sagte Scholz, sei eine Stunde der Trauer und der Demut. Über die Beteiligung der Stadt Bochum am Stromkonzern RWE, der auch Kernkraftwerke betreibt, sagte sie nichts. Auch zum Kauf von Steag-Anteilen durch die Stadtwerke, die auch im Nuklearbereich tätig ist fiel kein Wort. Und auch nicht darüber, dass die Stadtwerke noch immer fast 20 Prozent Atomstrom nutzen. Aber das wäre ja nicht demütig gewesen, sondern politisches Handeln.
Bochum am Stromkonzern RWE, der auch Kernkraftwerke betreibt, sagte sie nichts. Auch zum Kauf von Steag-Anteilen durch die Stadtwerke, die auch im Nuklearbereich tätig ist fiel kein Wort. Und auch nicht darüber, dass die Stadtwerke noch immer fast 20 Prozent Atomstrom nutzen. Aber das wäre ja nicht demütig gewesen, sondern politisches Handeln.
Das Bochumer Anti-Atomplenum ruft zusammen mit vielen anderen Gruppen und Initiativen am morgigen Montag, 21. März um 18.00 Uhr zu einer Anti-Atom-Mahnwache am Bochumer Hauptbahnhof auf. Wegen der gleichzeitig eintreffenden Fußballfans zum Spiel des VfL Bochum gegen Energie Cottbus wird die Mahnwache auf der anderen Straßenseite, also am Ende der Huestraße stattfinden.
Stand-up trifft Klesmer: Jüdisches (er)leben
 Heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Jüdischen Kulturtage. Nicht weniger als 500 Veranstaltungen werden rund um das diesjährige Motto „jüdisches [er]leben“ bis zum 17. April angeboten. Darunter finden sich Lesungen mit hochkarätigen Autoren wie Louis Begley und Rafael Seligmann, Auftritte von Stand-up-Comedian Oliver Polak sowie Themenabende mit dem vielversprechenden Titel „Happy Hippie Jew Bus“.
Heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Jüdischen Kulturtage. Nicht weniger als 500 Veranstaltungen werden rund um das diesjährige Motto „jüdisches [er]leben“ bis zum 17. April angeboten. Darunter finden sich Lesungen mit hochkarätigen Autoren wie Louis Begley und Rafael Seligmann, Auftritte von Stand-up-Comedian Oliver Polak sowie Themenabende mit dem vielversprechenden Titel „Happy Hippie Jew Bus“.
Bereits zum vierten Mal finden die Kulturtage in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland statt. Nahezu ganz NRW beteiligt sich an dem Programm. Alles in allem sind 52 Städte und 14 jüdische Gemeinden mit eigenen Veranstaltungen vertreten. Einen Schwerpunkt bildet dabei das Angebot aus den Gebieten Musik, Film, Bildende Kunst, Literatur, Tanz und Theater. Ein zweiter Themenkomplex der Kulturtage sind die zahlreichen Begegnungsprojekte. Sie sollen das Judentum einem nichtjüdischen Publikum näherbringen. So bieten etwa die Gemeinden in Essen, Herford und Mönchengladbach kostenlose Synagogenführungen an, in deren Rahmen Gemeindevertreter in jüdische Religion, Bräuche, Rituale und Feste einführen. Darüber hinaus wird der Journalist Michael Wuliger in mehreren Lesungen aus seinem ebenso witzigen wie bissigen Buch „Der koschere Kgnigge. Trittsicher durch die deutsch-jüdischen Fettnäpfchen“ vortragen.
Ein Blick in das Programm verrät, dass der Fokus der Kulturtage bewusst auf der Gegenwart zugewandter Themen liegt. In Köln beispielsweise trifft mit dem Liedermacher Hanjo Butscheidt jüdischer Charme auf Kölsche Lebensart; in Gelsenkirchen gibt es gleich an vier ganzen Tagen die Gelegenheit, die traditionelle, aber auch moderne aschkenasische und sephardische Küche kennenzulernen. Zwar soll auch dieses Mal eine ganze Reihe von Auftritten der obligatorischen – zumeist mit Nichtjuden besetzten – Klezmer-Bands ein authentisches Bild vom Judentum vermitteln. Doch angesichts der zum Teil ideenlosen Programme in den Vorjahren und der leeren Kassen in Nordrhein-Westfalen ist den Veranstaltern ein großes Kompliment zu machen. Ihnen ist es gelungen, die Erinnerung an die Opfer der Schoa wachzuhalten, ohne das heutige Leben der Juden in der Bundesrepublik aus dem Blick zu verlieren.
Man müsste schon den österreichischen Spötter Karl Kraus bemühen, um auch hier das viel zitierte Haar in der Suppe zu finden. Denn angesichts des prallen Programmkalenders der Kulturtage fragt man sich unweigerlich, wo man, um mit ebenjenem Kraus zu sprechen, nur all die Zeit hernehmen soll, so viele Veranstaltungen nicht zu besuchen. Jede Entscheidung für einen Abend ist zwangsläufig eine Entscheidung gegen mehrere andere, nicht weniger interessante Termine. Für die Schirmherren der Kulturtage, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Zentralratspräsident Dieter Graumann, könnte es indes keine schönere Beschwerde geben.
Fällt der Kulturherbst 2011 für freie Träger und Projekte in NRW aus?

Große Verunsicherung beim Grünen-Kulturratschlag im NRW-Landtag am Freitag – Erste Rufe nach einem Notfallplan – Bekommt ECCE im Ruhrgebiet mehr Einfluss?
Eingeladen hatten die Grünen im Landtag die Kulturszene NRWS zur Diskussion um den Kulturetat des Mix-Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Kultur und Sport (MFKJKS). Geplant war sicher, am letzten Freitag über den Kulturhaushalt insgesamt, aber auch Schwerpunkte, Perspektiven und mögliche Umverteilungen zu diskutieren. Doch die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts NRW zum Nachtragshaushalt 2010 und die Frage danach, ob und wann NRW in diesem Jahr überhaupt einen verfassungskonformen Haushalt verabschieden dürfte, interessierte die meisten Teilnehmer des Ratschlags sichtlich mehr.
Ein Text über Sarkozy (mit und ohne Fußnoten)

Frankreichs Präsident Sarkozy sorgt für Riesen-Ärger in Berlin. Nicolas Sarkozy will sich als Macher in der Libyen-Krise inszenieren. Die auf Betreiben Frankreichs mit britischer Unterstützung gefasste UN-Resolution ist für Sarkozy ein Erfolg, der auch dazu geeignet ist, sein angeschlagenes innenpolitisches Ansehen aufzubessern. Es war ein großer Augenblick für Präsident Nicolas Sarkozy: die Konferenz der Chefs von 22 Regierungen und internationaler Organisationen. Nun kann Sarkozy sie alle im Elysée-Palast willkommen heißen, unter ihnen US-Außenministerin Hillary Clinton, der britische Premier David Cameron, Spaniens Regierungschef José Luisa Zapatero, der Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Sarkozy liebt es, für Frankreich an der Spitze der Nationen zu stehen. Wahrscheinlich muss Nicolas Sarkozy gerade ein paar seiner Komplexe kompensieren.
Das Minderwertigkeitsgefühl etwa, bei den Revolutionen in Tunesien und Ägypten als Staatsmann mit Weltgeltung versagt zu haben. Anders sind die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten nicht zu erklären: Luftangriffe auf das libysche Gaddafi-Regime zu fordern und die Rebellenregierung anzuerkennen hat mehr mit seinem Testosteronspiegel als mit logischem Denken zu tun. Es wird – in Ägypten z.B. – ganz genau registriert, wie sich Europa verhält. Man kann nicht Demokratie predigen, aber mit Diktaturen ins Bett gehen. Ben Ali etwa wurde in Frankreich jahrelang von Sarkozy hofiert und nachdem er gestürzt wurde, lässt er ihn – wie mutig – nicht nach Paris einreisen. Das ist zutiefst heuchlerisch.
Goose
Goose, Montag, 21. März, 20.00 Uhr, Gebäude 9, Köln
Der Ruhrpilot
 Ruhrgebiet: Revierweiter Anti-Atom Protest am 2. April…Bo Alternativ
Ruhrgebiet: Revierweiter Anti-Atom Protest am 2. April…Bo Alternativ
Libyen: Angriffe werden von Deutschland aus koordiniert…Welt
Energie: Gelsenwasser gegen Gasbohrungen…Welt
Bochum: Studenten und Akafö fühlen sich von Bauvorhaben überrumpelt…Ruhr Nachrichten
Bochum II: Hauptstadt der Erdwärme-Forschung…Ruhr Nachrichten
Dortmund: Hauptstadt der Zwangsvollstreckung…Der Westen
Dortmund II: Ex-BVB-PräsidentGerd Niebaum im Fokus der Ermittler…Ruhr Nachrichten
Essen: Für Betreiber vom Studio Club ist Essen der Party-Magnet…Der Westen
Umland: Vom Verschwinden der öffentlichen Zeit …Zoom
Zurück zur Natur versus Fortschritts-Faszination …

Die toten Stahlgerippe nennen sich heute Gemini oder Medusa, wie sie im Industriedenkmal „Ferropolis“ nahe der Stadt Dessau zu bestaunen sind. Es sind nur noch monumentale, tote Kulissen, denn die Zeit des Braunkohle-Abbaus ist weitgehend abgeschlossene Vergangenheit. Eine dieser Monster-Maschinen ist „Hauptdarsteller“ in einem Stummfilm aus dem Jahre 1929 – jener „Sprengbagger 1010“, ein Titel, unter dem Carl-Ludwig Achaz-Duisberg das Genre des Industriefilms idealtypisch erfüllte. Mensch, Natur, und Technik befinden sich in hier Konfrontation zueinander, Kritik und Ästhetisierung scheinen gleichberechtigt zu sein. Einen solchen Blickwinkel favorisierte die Filmkunst in Zeiten, wo so vieles noch neu war.
Eine (Wieder-)Entdeckung ist „Sprengebagger 1010“ allemal, wie er jahrelang im Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin schlummerte. Ohnehin erleben Stummfilme ja ihre verdienstvolle Renaissance, seit sie nur zu gern von Orchestern aufgegriffen werden. Denn solche Live-Vertonungen eröffnen neue audio-visuelle Gesamterlebnisse, die zunehmend auch Menschen jenseits des bürgerlichen Klassikpublikums für die Welt der Sinfonik empfänglich machen. Zugleich helfen Stummfilm-Abende mit orchestraler Live-Musik, die Rezeption von Filmen von allem banal gewordenen Konsumhaften wieder zu befreien.
Samstag, 19.03.2011: Japan
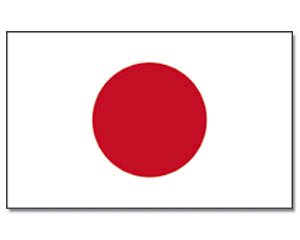 Es ist Samstag, der 19.03.2011. Die taz bringt eine Nachtzusammen-fassung über die Katastrophe in Japan. Sie schreibt: „Die Lage am Unglücks-Atomkraftwerk Fukushima I bleibt dramatisch. Technikern ist es zwar gelungen, ein Stromkabel zu verlegen. Doch wahrscheinlich sind die Kühlanlagen defekt.“
Es ist Samstag, der 19.03.2011. Die taz bringt eine Nachtzusammen-fassung über die Katastrophe in Japan. Sie schreibt: „Die Lage am Unglücks-Atomkraftwerk Fukushima I bleibt dramatisch. Technikern ist es zwar gelungen, ein Stromkabel zu verlegen. Doch wahrscheinlich sind die Kühlanlagen defekt.“
„Wenn die Nation zusammensteht, werden wir die Krise überwinden“, hatte Japans Ministerpräsident Naoto Kan schon vorgestern, also am Donnerstag, versichert. „Kan wird aller Wahrscheinlichkeit nach recht behalten“, bemerkte dazu Hartmut Wewetzer, der Leiter des Wissenschaftsressorts des Berliner Tagesspiegel. „Mehr noch: Die Japaner können am Ende gestärkt aus der Katastrophe hervorgehen.“ Diesen Kommentar publizierten sowohl der Tagesspiegel als auch Zeit Online.
„Noch immer ist zu wenig Wasser in den Kühlbecken der Reaktoren“, erfahren wir um 6:30 Uhr MEZ aus dem Liveticker des Hamburger Abendblatts. „Nach Angaben der japanischen Atomaufsichtsbehörde NISA ist der Stand im Reaktor 1 derart niedrig, dass er von den Messgeräten nicht mehr eindeutig erfasst werden kann.“ Also in allen Meilern, im Reaktor 1 sieht es ganz schlecht aus. Doch es gäbe Hoffnung, heißt es. Die Stromleitung zum Reaktor Nummer 2 stehe.
Zeit Online und der Tagesspiegel hatten Wewetzers Beitrag mit unterschiedlichen Überschriften und Einleitungen versehen. „Psychologen prophezeien Japan ein `posttraumatisches Wachstum´“, titelt die Zeit. Hoffnung in Zeiten der posttraumatischen Belastungsstörungen. Eine Frage der Psychologie. Das Urvertrauen spielt hier bekanntlich eine herausragende Rolle. „Die Japaner haben trotz der schwierigen Lage ihr Urvertrauen nicht verloren“, heißt es in der Einleitung von Zeit Online. Da kann Hartmut Wewetzer wirklich nicht dafür.
07:40 Uhr: „Leichenberge überfordern Gemeinden in Japan. Die Gemeinden in den japanischen Unglücksgebieten haben nach dem Erdbeben und Tsunami ein riesiges Problem mit den vielen Toten. Die Krematorien sind schlicht überfordert. In Japan sind Beerdigungen unüblich. Knapp 11.000 Menschen werden noch vermisst.“ „Seelisch“, leitet Zeit Online den Text von Hartmut Wewetzer ein, „ist der Mensch Krisen gewachsen und kann sie meistern.“ Seelisch. Körperlich steht die Sache freilich auf einem anderen Blatt.
“Posttraumatisches Wachstum“ – warum eigentlich nicht?! Auch an anderer Stelle findet sich der Hinweis, freilich nicht ohne das distanzierende Attribut „zynisch“, dass die Katastrophe letztlich vermutlich positive Wachstumseffekte nach sich ziehen werde. Wer weiß? In jedem Fall: positives Denken. Andererseits: sicher ist sicher. „09:26 Uhr: Europäischer Automarkt kaum von Katastrophe betroffen“.
11:20 Uhr: „Tokio wird von einem Nachbeben erschüttert, Gebäude wanken. Japanische Medien geben die Stärke zunächst mit 6,1 an. Ein Tsunami werde nicht befürchtet.“ Der Tagespiegel titelt „Wo aber Gefahr ist …“ und leitet Wewetzers Beitrag ein mit „… wächst das Rettende auch.“ 11:27 Uhr: „Japans Regierung hat eine Kernschmelze in drei Katastrophenreaktoren von Fukushima I `höchst wahrscheinlich´ genannt. Das berichtet die Nachrichtenagentur dapd ohne Angabe von Quellen.“
Premierminister Kan sagte am Freitag in seiner Fernsehansprache mit Tränen in den Augen: „Japan als Land wird die Katastrophe überwinden und sich erholen.“