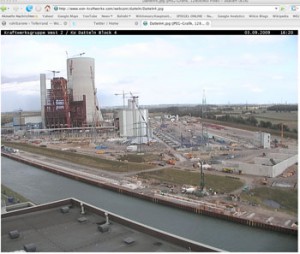Die Berliner Band „…e la luna?“ hat ihr neues Album „La Rosina bella“ herausgebracht: „Ein Muss“ für alle, die Kinder haben, und Italienisch sprechen. Ein reines Vergnügen für alle anderen, die nur gute Musik hören wollen. Von Andreas Lichte.
Die Berliner Band „…e la luna?“ hat ihr neues Album „La Rosina bella“ herausgebracht: „Ein Muss“ für alle, die Kinder haben, und Italienisch sprechen. Ein reines Vergnügen für alle anderen, die nur gute Musik hören wollen. Von Andreas Lichte.
Beim ersten Hören gefiel mir ein Stück gleich besonders gut: „Volevo un gatto nero“. Klasse, was man aus 3 Akkorden machen kann! Aus 2:50 Minuten. Und dann der Gesang von Eva Spagna, der sich so gar nicht nach Kinder-Kram anhört: Eher melancholisch und … böse, böse!
Da bin ich dann doch richtig neugierig geworden, und habe auch den Text gelesen. Ein Kinder-Lied, ganz klar. Ein kluges Spiel mit der kindlichen Phantasie, wo plötzlich alles lebendig wird, wenn man es nur will. Aber nur ein Kinder-Lied?
Was liest ein „Erwachsener“? Eine Frage, die sich jeder früher oder später stellt:
Was ist Deine „Schwarze Katze“?
Wofür würdest Du alles geben, was Du hast, den „ganzen Zoo“?
Helft mir doch bitte, eine Antwort zu finden. Und sagt mir, was eure „Schwarze Katze“ ist.
Ich wollte eine schwarze Katze
Ein echtes Krokodil,
ein echter Alligator:
Ich sagte dir, dass ich ihn habe
und dir gegeben hätte.
Die Abmachung war klar:
Das Krokodil für dich,
und du gibst mir
’ne schwarze Katze.
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze
und du gibst mir ’ne weisse
und das mach ich nicht mit
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze:
Weil du ein Lügner bist,
spiel ich nicht mehr mit dir.
Es war keine Giraffe
aus Plastik oder Stoff,
ne, echt, aus Fleisch und Blut
und die hätt’ ich dir gegeben.
Die Abmachung war klar:
Die Giraffe für dich,
und du gibst mir
’ne schwarze Katze.
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze
und du gibst mir ’ne weisse
und das mach ich nicht mit
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze:
Weil du ein Lügner bist,
spiel ich nicht mehr mit dir.
Einen indischen Elefant
mit ganzem Baldachin
hatt’ ich im Garten
und den hätt’ ich dir gegeben.
Aber die Abmachung war klar:
Der Elefant für dich,
und du gibst mir
’ne schwarze Katze.
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze
und du gibst mir ’ne weisse
und das mach ich nicht mit
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze:
Weil du ein Lügner bist,
spiel ich nicht mehr mit dir.
Die Abmachung war klar:
Der ganze Zoo für dich,
und du gibst mir
’ne schwarze Katze.
Ich wollte eine schwarze, schwarze, schwarze Katze
und du gibst mir ’ne weisse
und das mach ich nicht mit
Ich wollte eine schwarze Katze
na ja, schwarz oder weiss,
die Katze behalte ich
und du kriegst von mir nichts.
e la luna: cos’è il tuo „gatto nero“?
Il trio berlinese „…e la luna?“ ha pubblicato un nuovo CD-libro „La Rosina bella“: „un must“ per tutti quelli che hanno bambini e parlano l’italiano.
Un vero piacere per tutti gli altri che vogliono ascoltare buona musica.
di Andreas Lichte.
Al primo ascolto mi è piaciuto in particolar modo il brano: „Volevo un gatto nero“. Forte cosa si può fare con tre accordi! In 2.50 minuti. E poi la voce di Eva Spagna che non suona come roba per bambini, ma piuttosto malinconica e … cattiva, cattiva!
Quindi mi sono veramente incuriosito ed ho letto il testo. Una canzone per bambini, chiaro. Un gioco intelligente con la fantasia infantile, in cui improvvisamente tutto prende vita, se solo lo si vuole. Ma … solo una canzone per bambini?
Che cosa ci legge un “adulto”? Una domanda che prima o poi uno si pone:
Cos’è il tuo „gatto nero“?
Per che cosa daresti tutto quello che possiedi, il tuo “intero zoo”?
Aiutatemi per favore a trovare una risposta. E ditemi cosa è il vostro “gatto nero” …
Un coccodrillo vero,
un vero alligatore
ti ho detto che l’avevo
e l’avrei dato a te.
Ma i patti erano chiari:
il coccodrillo a te
e tu dovevi dare
un gatto nero a me.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
mi hai dato un gatto bianco
ed io non ci sto più.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
siccome sei un bugiardo
con te non gioco più.
Non era una giraffa
di plastica o di stoffa:
ma una in carne ed ossa
e l’avrei data a te.
Ma i patti erano chiari:
una giraffa a te
e tu dovevi dare
un gatto nero a me.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
mi hai dato un gatto bianco
ed io non ci sto più.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
siccome sei un bugiardo
con te non gioco più.
Un elefante indiano
con tutto il baldacchino:
l’avevo nel giardino
e l’avrei dato e te.
Ma i patti erano chiari:
un elefante a te
e tu dovevi dare
un gatto nero a me.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
mi hai dato un gatto bianco
ed io non ci sto più.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
siccome sei un bugiardo
con te non gioco più.
I patti erano chiari:
L’intero zoo per te
e tu dovevi dare
un gatto nero a me.
Volevo un gatto nero, nero, nero,
invece è un gatto bianco
quello che hai dato a me.
Volevo un gatto nero,
ma insomma nero o bianco
il gatto me lo tengo
e non do niente a te.
homepage von … e la luna?
Releasekonzert von „La Rosina bella“:
Sonntag, 21. November 2010, 15 Uhr, in der Werkstatt der Kulturen