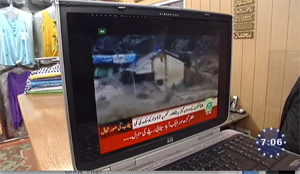In Zeiten eines dramatischen Lehrermangels suchen auch die Waldorfschulen verzweifelt Nachwuchs an „Erziehungskünstlern“. Der „Bund der Freien Waldorfschulen“ hat die Website „Waldorflehrer werden – Bildung fürs Leben“ geschaffen, um für einen Beruf zu werben, der, Zitat, „eine echte Bereicherung für Ihr Leben sein kann.“ Auch für Ihres? Von unserem Gastautor Andreas Lichte.
In Zeiten eines dramatischen Lehrermangels suchen auch die Waldorfschulen verzweifelt Nachwuchs an „Erziehungskünstlern“. Der „Bund der Freien Waldorfschulen“ hat die Website „Waldorflehrer werden – Bildung fürs Leben“ geschaffen, um für einen Beruf zu werben, der, Zitat, „eine echte Bereicherung für Ihr Leben sein kann.“ Auch für Ihres? Von unserem Gastautor Andreas Lichte.
Als besonderen Service bieten die Ruhrbarone ihren Lesern einen Schnell-Eignungstest an. Sie müssen nur die folgenden Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten und schon wissen Sie, ob Sie für den Beruf des Waldorflehrers geeignet sind:
– ist Eurythmie Kunst?
– ist Rudolf Steiner ein bedeutender Naturwissenschaftler?
– ist es Wissenschaft, wenn im Waldorf-Schulgarten Kuhhörner nach dem Mondkalender vergraben werden?
Wer dreimal mit „Ja“ geantwortet hat, sollte unbedingt weiterlesen, um noch mehr über seinen Traumberuf zu erfahren.
„Wie in jeder anderen Schule geht es in Waldorfschulen um die Vermittlung wissenschaftlich gesicherten Wissens …“ schreibt der Bund der Freien Waldorfschulen, vergisst aber darauf hinzuweisen, dass anthroposophische „Geisteswissenschaft“ weit über das übliche universitäre Wissen hinausgeht. Was immer wieder zu Unverständnis führt. So schreibt der SPIEGEL im Artikel „Die Lehre von Atlantis“: „(…) Dass empirische Forschung nichts zählt, steht sogar im »Studienbegleiter« für angehende Waldorflehrer an der anthroposophischen Freien Hochschule Stuttgart. Anfänger müssen am staatlich anerkannten Seminar Steiners Buch »Theosophie« nicht nur lesen, sondern dabei auch eine »geistige Schulung« durchlaufen, bei der »Inhalte nicht kommentiert oder interpretiert« werden. Ziel ist, wortwörtlich, das »allmähliche Hinaufarbeiten zur Ebene eines produktiven Erkennens, das im Gegensatz zu den analytischen Erkenntnismethoden steht«.
In seinem umfangreichen Gesamtwerk fabuliert Steiner von Geistwesen, Äther-, Astral- und physischen »Leibern«, »atlantischen Kulturepochen« eines Erdzeitalters und vor allem von der »Akasha-Chronik«. Aus dieser geheimnisvollen Schrift wollte Steiner seine Erkenntnisse auf hellseherische Weise gewonnen haben. Praktisch, dass dieser sagenumwobene Geistesschatz ihm exklusiv zur Verfügung stand. Nahezu nichts ist im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das wusste Steiner natürlich und beschied Kritiker mit dem Satz: »Schon der Einwand: ich kann auch irren, ist störender Unglaube.« (…)“
Störenden Unglauben zeigte auch das ZDF, Frontal 21, in seinem Beitrag „Kritik an Waldorf-Lehrern – »Wir haben die meiste Zeit gesungen«“. Dort heisst es: „Ein Beleg solcher Qualifikation [als Waldorflehrer] sind Abschlussarbeiten wie diese der Freien Hochschule Stuttgart. Sie lobt ausdrücklich eine Arbeit mit dem Titel: »Verstehen von Pflanzen durch lebendige Begriffe«. Es geht um Primelgewächse, angebliche Erdkräfte und Pflanzencharaktere. Erfüllen solche Diplomschriften wissenschaftliche Maßstäbe? Josef Kraus, Präsident Deutscher Lehrerverband, antwortet: »Die erfüllen nicht mal den Anspruch, der gestellt wird an die Facharbeit eines Zwölft- und Dreizehntklässlers. Ich würde eine solche Arbeit am Gymnasium als Zulassungsarbeit, als Facharbeit zum Abitur nicht annehmen.«“
Der Deutsche Lehrerverband kennt noch mehr Diplomarbeiten, die die staatlich anerkannte „Freie Hochschule Stuttgart“ selber lobte , nachzulesen hier: Schule und Lehrerbildung im Zeichen von Atlantis und Saturn. Um den zukünftigen Waldorflehrern zu zeigen, dass wirklich alles möglich ist, hier noch ein weiteres Beispiel:
„Vom Mai 2006 stammt die Arbeit »Alternative Betrachtungen zum Krankheitsbild AD(H)S«, also zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Eine der zentralen Aussagen lautet: »Es geht hier vor allem um kosmische und irdische Einflüsse.« Anschließend folgen seitenlang Betrachtungen etwa über den Kalender der Maya, das Wassermann-Zeitalter, die Metamorphose vom Geistigen ins Physische und die in Revolutionsjahren (etwa 1789, 1848 und 1917) ausgeprägten Sonnenfleckenmaxima.“
„Sie gestalten Ihre Schule selbst – unabhängig von wechselnden Erlassen und Verordnungen, in voller Selbstverwaltung, gemeinsam mit gleich gesinnten Kollegen“ schreibt der Bund der Freien Waldorfschulen, und betont die Unabhängigkeit der Waldorfschulen von staatlichen Vorgaben. Eine staatliche Schulaufsicht gibt es – de facto – nicht. So berichtet der WDR in seinem Artikel „Wie werden die »Ersatz-Schulen« kontrolliert? – Hinter privaten Schultüren“ über ein Gewaltopfer an der Waldorfschule Schloss Hamborn, Zitat:
„Als er sich daraufhin an die Bezirksregierung Detmold wandte, habe man ihm dort erklärt, dass die Behörde für private Schulen, wie Waldorf- oder auch kirchliche Schulen, nicht zuständig sei. Auch auf eine Petition beim Landtag NRW hin bekam der ehemalige Schüler dieselbe Auskunft. Das »Verhalten der Lehrkraft«, heißt es in einem Antwortschreiben, das WDR.de vorliegt, »konnte keine schulaufsichtliche Maßnahme auslösen«, da die Lehrkraft nicht Bedienstete des Landes Nordrhein-Westfalen war, sondern in einem privatrechtlichen Vertragsverhältnis zum Schulträger stand«.“
„In der Waldorfschule muss die Freiheit wohl grenzenlos sein …“ Aber welche Aufgaben hat denn nun ein Waldorflehrer?
„Als zukünftige Lehrerin“, belehrte mich Herr Klein, „haben Sie die Aufgabe, den Himmel in den Klassenraum zu bringen. Alles andere ist zweitrangig. Auch die Wissensvermittlung“ berichtet Nicole Glocke in ihrem Erfahrungsbericht „Inkarnieren zum Klavier“ aus dem „Seminar für Waldorfpädagogik Berlin“.
„Himmel in den Klassenraum bringen“? Na, das sollte doch für einen „Erziehungskünstler“ kein Problem sein. Und auch nicht für Sie, Sie haben ja schliesslich schon den Ruhrbarone-Eignungstest bestanden.
Info: Die Waldorfschule, Rudolf Steiner, und die Anthroposophie
Die erste Waldorfschule wurde 1919 in Stuttgart vom Anthroposophen Emil Molt, Besitzer der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, als Betriebsschule gegründet. Molt beauftragte Rudolf Steiner mit der pädagogische Leitung der neuen „Waldorf“-Schule.
Rudolf Steiner (1861–1925) promovierte 1891 mit der schlechtmöglichsten Note „rite“ in Philosophie; die 1894 versuchte Habilitation scheiterte. Um 1900 kam er in Kontakt mit Helena Petrovna Blavatskys esoterischer „Theosophie“. Von 1902 bis 1912 leitete Steiner die deutsche Sektion der „Theosophischen Gesellschaft“, die er 1912/13 abspaltete und unter dem Namen „Anthroposophie“ neu gründete.
Steiner ist nach eigener Aussage Hellseher. Er behauptet, in der „Akasha-Chronik“, einem allumfassenden „Geistigen Weltengedächtnis“ im „Äther“lesen zu können. Steiner erklärt: „Erweitert der Mensch auf diese Art [d.h. durch Steiners Anthroposophie] sein Erkenntnisvermögen, dann ist er (…) nicht mehr auf die äußeren Zeugnisse angewiesen. Dann vermag er zu schauen, was an den Ereignissen nicht sinnlich wahrnehmbar ist (…).“Die Anthroposophie schöpft damit aus esoterischen, okkulten Quellen, die für Nicht-Anthroposophen reine Fiktion sind.
Die Waldorfschule war für Steiner von Beginn an ein wirksames Instrument zur Verbreitung seiner esoterischen Heilslehre „Anthroposophie“. Und die „Anthroposophie“ ist bis heute verbindliche Grundlage des Unterrichts jeder Waldorfschule, Rudolf Steiner deren unangefochtene Autorität. Wie weit die Verehrung geht, mag man am Umfang der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe ermessen: Sie hat zurzeit 354 Bände.
Zum Autor: Andreas Lichte ist ausgebildeter Waldorflehrer und Grafiker, lebt in Berlin. Er ist Autor kritischer Artikel zur Waldorfpädagogik und Anthroposophie. Er erstellte für die „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) ein Gutachten zur Indizierung zweier Werke Rudolf Steiners, die fortan nur noch in kommentierter Form erscheinen dürfen.
Andreas Lichte bei den Ruhrbaronen:
„Waldorfschule: Vorsicht Steiner“
Interview mit Andreas Lichte
„Kampf bis zur Erleuchtung – Lorenzo Ravagli und der Glaubenskrieg der Anthroposophie gegen Helmut Zander“
„Die Waldorfschulen informieren“
„Drei Gründe für die Waldorfschule“
Waldorfschule: „Detlef Hardorp, der Berlin-Brandenburgische Bullterrier der anthroposophischen Öffentlichkeitsarbeit“

 Nicht nur im Pott gibt es Leute, die sich unbedingt zu Lebzeiten ein Denkmal setzen wollen. Noch schlimmer als RUHR.2010 ist die Shanghai EXPO 2010.
Nicht nur im Pott gibt es Leute, die sich unbedingt zu Lebzeiten ein Denkmal setzen wollen. Noch schlimmer als RUHR.2010 ist die Shanghai EXPO 2010.wird mir wohl nicht mehr passieren, dass ich mich durch so ein Ding quäle….