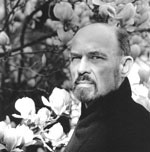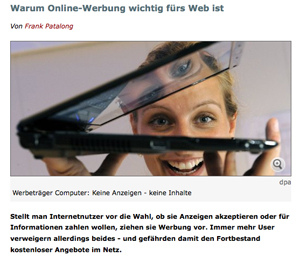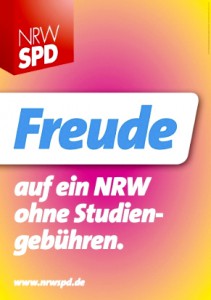Die Waldorfschule stellt ihr pädagogisches Projekt oft als eine soziale Frage heraus. Das hat mit der Tatsache zu tun, dass die Waldorfschule aus einem sozialen, politischen Impuls entstand.Von unserem Gastautor von Ramon De Jonghe .
Die Waldorfschule stellt ihr pädagogisches Projekt oft als eine soziale Frage heraus. Das hat mit der Tatsache zu tun, dass die Waldorfschule aus einem sozialen, politischen Impuls entstand.Von unserem Gastautor von Ramon De Jonghe .
Mit seiner Idee der „Sozialen Dreigliederung“[1] behauptete Rudolf Steiner seinen Anspruch, die bestehende Gesellschaft reformieren zu können. Nicht nur die Deutsche Gesellschaft lehnte Steiners Plan ab. Selbst seine eigenen anthroposophischen Unterstützer zeigten wenig Interesse an Steiners politischen Ambitionen. Sie konnten nicht verstehen, dass ihr verehrter Meister, ein Eingeweihter in „Höheres Wissen“, sich mit „schmutziger Politik“ beschäftigte. Die soziale Revolution, oder Erneuerung, wie Steiner sie gern sehen wollte, blieb aus. Aber das bedeutete nicht, dass Steiner es aufgab, seine anthroposophische Heilslehre zu verbreiten. Er suchte nach anderen Wegen, die „Unerleuchteten“ zu erreichen.
Steiners guter Freund, der „Waldorf-Astoria“ Zigaretten-Fabrikant und Anthroposoph Emil Molt, gab Steiner dazu die Gelegenheit. Molt machte den Vorschlag, eine Schule für die Arbeiter seiner Fabrik zu gründen. Als Steiner klar wurde, dass er keinerlei Einfluss auf das politische Leben hatte, stimmte er zu, Leiter der neuen Schule zu werden. 1919 präsentierte Steiner die erste Waldorfschule als eng mit seiner Idee der „Dreigliederung“ verbunden:
„… Wir möchten diese neue Schule schaffen wie ein Beispiel; diese Schule, nach der sich eigentlich ahnungsvoll viele Menschen sehnen, die man aber nicht den Mut hat, wirklich ins Auge zu fassen. Glauben wird man müssen, verstehen wird man müssen, daß dasjenige, was man soziale Frage nennt, durchaus auch an der so charakterisierten Schulfrage hängt; daß dasjenige, was man soziale Umwandlung nennt, sich nicht zuletzt in der Weise wird vollziehen müssen, wie das bei der Waldorfschule versucht wird. Es würde ein ungeheurer Schaden sein, wenn gerade der soziale Impuls verkannt würde, welcher der Begründung der Waldorfschule zugrunde liegt. … „[2]
Man M U S S glauben und M U S S verstehen? Spricht hier der Autor der „Philosophie der Freiheit“? Jedenfalls konnten durch die Waldorfschule von Anfang an anthroposophische Prinzipien einen Platz in der Gesellschaft erobern, da die Schule ein Teil der „Dreigliederung“ war. Die Aussage des Erziehungswissenschaftlers Professor Klaus Prange: „Die Waldorfpädagogik und die Waldorfschule sind der Versuch, diese Heilsbotschaft über Erziehung auf Dauer zu stellen“, kommt wahrlich nicht aus heiterem Himmel.
Bis heute hat die Waldorfschule die Erwartungen ihres Begründers auf soziale Erneuerung nicht erfüllt. Im Gegenteil. Die Geschichte der Waldorfschule zeigt eine Spur von unsozialem Verhalten, in dem Intrigen, Einschüchterungen und Drohungen nicht fehlen. Wie sehr sich Steiners Verehrer auch bemühen, dies anders zu sehen, ist eine Waldorfschule doch weit von einem Beispiel für eine Gemeinschaft entfernt, die wirklich „sozial“ genannt werden könnte. Dies wird deutlich, wenn wir einen Blick auf das Zeugnis von Menschen werfen, die massive Auseinandersetzungen mit Waldorflehrern, Waldorfsprechern oder Anthroposophen hatten. Man könnte sich fragen: Wie kann es sein, dass eine Gemeinschaft, in der es so viele Menschen gibt, die die „Wahrheit“ gefunden zu haben glauben, solch ein Desaster an menschlichen Beziehungen hervorbringt?
Natürlich werden Waldorfschulen dieses Problem nicht eingestehen. Nein, sie sprechen lieber in ihrem blumigen Jargon von „Dingen, die ihren Weg auf ihrer Reise kreuzen“ oder von „karmischen Gesetzen, die Teil eines höheren Plans sind“. In vielen Fällen werden Entschuldigungen vorgebracht, um das unsoziale Verhalten zu „erklären“. Wie: „Die Waldorfschule ist ein soziales Experiment; vergleiche sie mit einem sozialen Laboratorium; unsere Schüler sind sozial kompetenter als andere; Arbeit für die Freiheit hat seinen Preis; Menschen, die in einem vorherigen Leben Feinde waren, kommen nun in der Waldorfschule zusammen und müssen ihr Karma bewältigen, was Spannungen mit sich bringt; …“ Diese Antworten sind nicht wirklich überzeugend, aber dies ist auch nicht wirklich wichtig: Die Menschen M Ü S S E N glauben und verstehen …
Wird vollständiges Leugnen das unsoziale Verhalten der Waldorfschulen ändern? Sind Anthroposophen wirklich solche Idioten, dass sie glauben, dass ein Problem durch Leugnung gelöst werden kann? Sicher, sie M Ü S S E N Probleme abstreiten. Sie M Ü S S E N etwas anderes glauben. Oder vielleicht besser: Sie M Ü S S E N dem „Volk“ etwas anderes glauben machen, was in der Tat bedeutet: eine „Mogelpackung“ verkaufen.
Ausser Hörweite der Öffentlichkeit sprechen die Verehrer der Waldorfschule eine andere Sprache. Der bekannte Niederländische Anthroposoph und ehemalige Waldorflehrer Wim Veltman schrieb eine Broschüre über die Probleme in Waldorfschulen. Diese Broschüre wurde nie veröffentlicht, wird aber als Flugblatt unter Anthroposophen und Waldorflehrern verbreitet. Veltman stellt klar, dass „wenn es einen Ort gibt, wo sich die unsoziale Strömung eingenistet hat, es in der Freien Schule ist [„Freie Schule“, d.h. Waldorfschule]“. Seine Kritk beschränkt sich nicht auf die Niederländischen Waldorfschulen, sondern gilt für die Waldorfschulen weltweit:
„In achtzig Jahren der Freien Schulbewegung in den Niederlanden und anderswo in der Welt ist die soziale Struktur der Freien Schule ein beständiges Problem gewesen. Wenn sich die „unsoziale Strömung“ im letzten Jahrhundert irgendwo hat ausleben können, dann war es in den Freien Waldorfschulen (eine vereinzelte Ausnahme nicht in Erwägung genommen). Und dies, obwohl die Waldorfschule, in gewissem Sinne, aus einem sozialen Erneuerungs-Impuls hervorging!“[3]
Es gibt ein Sprichwort: „The tools of improvement don’t always fit the hand in need“ [„Die Werkzeuge zur Verbesserung passen nicht immer zur Hand, die sie braucht“]. In diesem Fall sind die Werkzeuge Steiners „Einsichten“, die aus seiner okkulten Weltsicht stammen, während die Hand, die sie braucht, die Schüler repräsentiert. Dass die Hand nicht nur leer bleibt, oder nicht die richtigen Werkzeuge bekommt, um nach dem Waldorfschulleben weiter zu kommen, sondern sie auch sozial gelähmt wird, hat schon der Schulpsychologe Fritz Beckmannshagen in seiner kritischen Studie gezeigt.
Nach der Lektüre des Erziehungswissenschaftlers Prange und der anthroposophischen Autorität Veltman kann ich nur zu dem Schluss kommen – und dies auch in Hinblick auf meine eigenen Erfahrungen, als ich noch selber in der Waldorfbewegung aktiv war –, dass die soziale Umgebung einer Waldorfschule in keiner Weise Kindern die Grundlage bieten kann, eigenverantwortliche, soziale menschliche Wesen zu werden.
Zum Autor: Ramon De Jonghe arbeitete als Erzieher in einer Waldorfschule, war im Vorstand dieser Waldorfschule. Er war ehrenamtlich für die Rudolf Steiner Akademie tätig, studierte an einer anthroposophischen Hochschule. Drei seiner Kinder besuchten für einige Jahre zwei verschiedene Waldorfschulen. Er arbeitet zur Zeit als freier Mitarbeiter an der Universität von Antwerpen als Assistent für Prüfungen zur Sprachentwicklung von Kindern.
Homepage von Ramon De Jonghe…Klack
[1] vergleiche Klaus Prange, “Erziehung zur Anthroposophie”, S. 165:
“Das Einzige, was Steiner als Movens für die künftige Ordnung anerkennt, ist das »freie Geistesleben« [»freie Geistesleben«, d.h. die Anthroposophie]. Von diesem »Zufluß« werden »sowohl der politische Staat wie das Wirtschaftsleben« profitieren (R. Steiner, GA 23). Wenn alle vernünftig und anthroposophisch sind, wird auch die rechte Welt da sein:
»Auf dem Gebiete des politischen Staates werden sich die notwendigen gesunden Ansichten durch eine solche freie Wirkung des Geistesgutes bilden (ebd.).«
Insofern fällt bei aller Gleichwertigkeit der Einzelglieder doch dem Geistesleben eine Führerrolle zu, so wie sich Plato die Philosophen als Herrscher über die Restklassen der Gesellschaft dachte.”
[2] R. Steiner, „Vortrag für die Eltern der Waldorfschulkinder“, Stuttgart, 31. August 1919, GA 297
[3] W. F. Veltman, „De Vrije School – Ondergang en nieuwe geboorte?“, Den Haag 2000
 Bergbau-Subventionen zu steichen ist immer eine gute Idee. Die Folklore-Industrie sollte möglichst schnell beendet werden. Aber nur von Bergbau-Subventionen zu sprechen ist billig.
Bergbau-Subventionen zu steichen ist immer eine gute Idee. Die Folklore-Industrie sollte möglichst schnell beendet werden. Aber nur von Bergbau-Subventionen zu sprechen ist billig.