
Falls sich einer fragt, was die Russen von Gazprom in Deutschland so machen. Der muss nur dem Trikot der Schalker folgen. Denn das hängt in der Zentrale der Gazprom-Filiale in Berlin. Nur einen Steinwurf vom Checkpoint Charly entfernt. Die Empfangsdame von Gazprom Germania blättert hier gewöhnlich lustlos in einer Zeitschrift. Und manchmal kaut sie Kaugummi. Hier hinter dem Trikot beginnt der operative Brückenkopf des russischen Staatskonzerns Gazprom in Westeuropa.
Während die großen strategischen Entscheidungen in Petersburg und Moskau fallen, laufen in Berlin die Fäden aus England und Amerika, aus der Schweiz und Zentralasien zusammen. Es geht um Expansion und Zukäufe, um Firmenübernahmen und vertraulichen Geldverkehr. Und dabei werden über die Berliner Filiale auch schon mal Zahlungen an fragwürdige Firmen organisiert. Ich war da und habe mir die Bilanzen und Geschäftsberichte besorgt.
Der Weg des Geldes führt durch ein Labyrinth von Banken an verschwiegenen Plätzen. Im Organigramm der Gazprom Germania tauchen immer neue Firmen mit Verbindungen in alle Ecken der Welt auf, von den Cayman Islands bis nach Kasachstan. Vor allem Usbekistan spielt in der Gazprom-Strategie eine wichtige Rolle. In der zentralasiatischen Steppe liegen riesige Gas- und Ölvorkommen, zum größten Teil noch unerschlossen.
Bislang ist das Geschäft für die Gasputins recht einfach. Alle Leitungen aus Usbekistan in den Westen stehen unter Kontrolle von Gazprom. Die Russen müssen nur den Rohstoff bei den Despoten Zentralasiens einkaufen und es auf den europäischen Märkten für den dreifachen Preis weiterverkaufen. Erst wenn es den Europäern gelingt, über eine eigene Pipeline Zugang zu den asiatischen Lagerstätten zu finden, könnte es mit den einfachen Margen zu Ende gehen.
Doch die zaghaften Geschäftsanbahnungen des Westens können die Gazoviki bislang leicht unterlaufen. Gerade zum usbekischen Diktator Islam Karimow pflegen sie gute Beziehungen. Dabei werden die Verbindungen über ihre deutsche Filiale organisiert. Die Spur führt von Berlin in die Schweiz nach Zürich. Hier sitzt eine Tochter der Berliner Gazprom Germania mit dem Namen ZMB Schweiz. Diese Firma kauft nach eigenen Angaben im Namen von Gazprom Gas in Usbekistan ein.
Erstaunlicherweise aber nicht nur über die staatlichen usbekischen Gasproduzenten, sondern vor allem über die Firma Zeromax. Alleine im vergangenen Jahr waren es nach Gazprom-Angaben sechs Milliarden Kubikmeter. Der Wert allein dieser Lieferungen lag nach einer Vereinbarung zwischen Gazprom und dem usbekischen Staat bei über 400 Millionen Euro. Die entsprechenden Einkaufskurse betrugen nach Angaben der Bundesagentur für Außenwirtschaft (Bfai) 70 Euro je 1000 Kubikmeter.
Das Gas lieferte die Gazprom-Tochter ZMB Schweiz nach eigenen Angaben vor allem in den Kaukasus und in die Ukraine. Ein gänzlich uninteressanter Deal, versichert Gazprom Germania. "Zeromax ist ein normaler Geschäftspartner von uns", sagt ein Firmensprecher. Normalität ist relativ. Die Firma Zeromax sitzt ebenfalls in der Schweiz und zwar im Steuerparadies Zug, in der Poststraße 30. Im Erdgeschoss des Hauses ist ein Laden für Farben und Lacke. An den Briefkästen kleben dutzende Firmenschilder. Ich war da und bin in die Zentrale gegangen.
Die drei Zimmer der Firma Zeromax sind in der dritten Etage des Betongebäudes bescheiden eingerichtet. Direkt hinter der Eingangstür steht ein schmaler Tisch. Dahinter hängt ein Ölbild mit einer usbekischen Landschaft. Obwohl hunderte Millionen Euro durch die Bücher des Unternehmens fließen, braucht es offenbar nicht mal Aktenschränke. In der Zeromax-Zentrale sind lediglich zwei Angestellte und der Geschäftsführer Ikromjon Yokubov, 32, zu sehen.
Das interessante an der bescheiden eingerichteten Firma ist ihre Geschichte: Sie wurde 1999 in Delaware, USA, unter dem Namen Zeromax LLC gegründet. Erst im Jahr 2004 siedelte die Firma in die Schweiz um. Im Geschäftsbericht der Gazprom Germania Tochter ZMB taucht Zeromax erstmals im Frühjahr 2004 als Partner auf. Nach Auskunft von Zeromax-Insidern, sowie mehrerer Quellen aus Usbekistan selbst, soll Zeromax über Strohmänner Gulnara Karimowa gehören, der Tochter des usbekischen Präsidenten. Dies bestätigte der ehemalige Finanzbevollmächtigte von Gulnara Karimowa, Farhad Inoghamboev, gegenüber mehreren Zeugen.
Auch ein leitender Beamter in der deutschen Botschaft in Taschkent bestätigte anonym, dass Zeromax zum Karimowa-Reich gehört. Aus dem Umfeld der Führungsebene von Gazprom Germania heißt es dazu, es sei dem Konzern bekannt, dass hinter Zeromax die usbekische Präsidententochter steckt: "Aber zeigen Sie mir ein zentralasiatisches Land, wo sie nicht solche Konstellationen haben", sagt der Gazprom-Insider.
Das bedeutet zusammengefasst: Die deutsche Gazprom-Tochter bezahlt über eine Schweizer Firma für Gas, das die Russen in Usbekistan kaufen, Bares an eine Firma aus dem Dunstkreis der usbekischen Präsidentenfamilie.
Ich weiß nicht, ob man das schon als Schmiergeldzahlungen bezeichnen kann. Jedenfalls hat mir ein Manager aus dem Ölgeschäft gesagt, das oft solche Geschäfte über dubiose Zwischenhändler organisiert werden, wenn es darum geht, Handgelder für Potentaten zu verschleiern.
In Deutschland kann das aber riskant für Gazprom werden. Denn die Berliner Filiale untersteht deutschem Recht. Und hier gilt das Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Bestechung. Danach steht das Schmieren ausländischer Staatsmänner unter Strafe. „Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts“, heißt es in dem Gesetz. Deutsche Unternehmen müssen laut Gesetz damit rechnen, dass alles Geld, das sie mittels Bestechung verdient haben, beschlagnahmt wird. Es ist offen, ob die Staatsanwaltschaft Berlin in dem Dreieckshandel Gazprom-Germania-Zermomax-Usbekistan Gründe finden für einen Anfangsverdacht sehen könnte.
Gazprom Germania jedenfalls sieht in dem Kreuz- und Querhandel keine Bestechung und damit auch nicht die Gefahr von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Das Geschäft sei schließlich völlig alltäglich: "Wir bezahlen ganz normal unsere Rechnungen." Man habe auch nichts mit der Präsidenten-Tochter Karimowa zu tun, sondern verhandele allein mit dem Zeromax-Geschäftsführer Yokubov, versichert ein Gazprom-Sprecher.
Unterdessen bestreitet Zeromax-Geschäftsführer Yokubov eine Beteiligung der Präsidenten-Tochter an seiner Firma. "Diese Geschichte stimmt nicht", sagte Yokubov. Offiziell gehört die Firma mit einem Stammkapital von 20.000 Schweizer Franken auch dem Ehepaar Djalalov aus Taschkent. Diese seien allerdings Strohmänner, sagte der frühere Karimowa-Vertraute Inoghamboev gegenüber mehreren Zeugen.
In Usbekistan spielt die Firma Zeromax eine große Rolle. In einem Verfahren vor dem US-Bundesgericht in Houston, Texas präsentierte die amerikanische Firma Interspan Distribution Dokumente, aus denen ersichtlich ist, wie die Präsidententochter Karimowa mit Hilfe ihres Papas rund um Zeromax ein wirtschaftliches Schattenreich aufbaut. Wer sich nicht fügt, bekommt auch schon mal Ärger. So beschrieb Interspan, wie ein leitender Angestellter in Usbekistan verhaftet und misshandelt worden sein soll, nachdem sich das Unternehmen geweigert habe, Zeromax am eigenen Tee-Handel in Usbekistan zu beteiligen. Erst als man die Beteiligungen im Jahr 2006 in Usbekistan aufgegeben habe, sei der Angestellte aus der Haft entlassen worden, erklärte Interspan. Seither versucht die Firma vor dem Gericht in Texas Geld von einem Exportversicherer einzuklagen.
Die britische Firma Oxus kann von ähnlichen Erfahrungen berichteten. So wurde dem Unternehmen in Usbekistan ein Steuerverfahren angehängt, das erst fallengelassen wurde, nachdem Zeromax in die usbekische Goldmine der Briten einsteigen durfte. Auf diese Art und Weise entstand aus Zeromax ein monströses Konglomerat. Wie aus einer Eigendarstellung der Firma hervorgeht, gehören dem Schweizer Dreimannbetrieb Hühnerfarmen, Gasquellen, Modelabel, Tankstellen, sowie Kühlhäuser.
Wer in Usbekistan Geschäfte machen will, fügt sich besser den Bedingungen. Der Brauseproduzent Coca Cola etwa gründete schon Anfang der Neunziger Jahre gemeinsam mit der Firma Roz Trading eine zentralasiatischen Abfüllungsanlage mit dem Namen "Coca Cola Bottlers". Roz Trading selbst gehörte dem Mann von Gulnara Karimowa. Lange ging alles gut. Doch als sich das Ehepaar trennte, musste der Karimowa-Gatte nach Amerika flüchten und der usbekische Staat übernahm im Jahr 2002 die Anteile der Roz Trading am Cola-Geschäft und gab diese später an Zeromax weiter.
Fast gleichzeitig floss womöglich auch direkt aus Cola-Kassen Geld an Karimowa. Das geht aus internen Buchungsunterlagen der Firma Revi Holdings mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hervor. Diese Firma gehört nach einem vorliegenden Handelsregisterauszug Gulnara Karimowa persönlich. Eine Firma namens "Coca Colabottlers" zahlte danach allein im Jahr 2003 in vier Tranchen 699753,22 US-Dollar an das Karimowa-Unternehmen. Coca Cola wollte nicht sagen, ob diese Zahlungen möglicherweise von der usbekischen Tochter "Coca Cola Bottlers" stammen.
Seit 2003 ist Zeromax in den USA jedenfalls wegen der Cola-Geschichte in Schwierigkeiten. Der Mann von Gulnara Karimowa verlangte, dass Zeromax ihm die Anteile am Coca-Cola-Geschäft in Usbekistan herausgibt. Zeromax habe die Beteiligungen nur erhalten, weil er von seiner Ex-Frau erpresst worden sei, schrieb der Ex-Gatte an das US-Bundesgericht in Washington DC. Bis heute läuft ein Prozess mit ungewissem Ausgang.
Nahezu zeitgleich begann Gazprom Verhandlungen mit Usbekistan über eine Ausweitung des Gashandels. Eine Schlüsselfigur des Geschäfts war der Oligarch Alisher Usmanov. Er soll angeblich über 80 Millionen US-Dollar an Schmiergeldern an Gulnara Karimowa gezahlt haben, um unter anderem das Exportgeschäft zu sichern, schrieb der damalige britische Botschafter in Usbekistan, Craig Murray, unter Berufung auf eigene Quellen in seinem Buch "Murder in Samarkand".
Usmanow selbst – der gebürtige Usbeke ist unter anderem auch Generaldirektor der Gazprominvestholding – bestreitet dies öffentlich. Er habe nie intensive Kontakte zur Präsidententochter unterhalten. Und Schmiergeld sei auch nicht geflossen. Im Jahr 2004 schließlich schloss Gazprom mit dem usbekischen Präsidenten Karimow einen neuen Gas-Liefervertrag. Fast zeitgleich erhielt Zeromax Beteiligungen an wichtigen usbekischen Gasfeldern. Im gleichen Atemzug siedelte Zeromax in die Schweiz um und die Überweisungen über die Gazprom-Germania-Tochter setzten ein.
Wow, was ein Riemen.



 Grosser-Bruder-Foto: Ruhrbarone
Grosser-Bruder-Foto: Ruhrbarone Bild: Ruhrbarone
Bild: Ruhrbarone Bild: Ruhrbarone
Bild: Ruhrbarone Bild: dieludolfs.de
Bild: dieludolfs.de
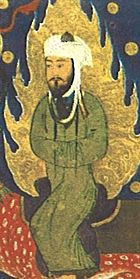

 Foto: Ruhrbarone
Foto: Ruhrbarone  Foto: Ruhrbarone
Foto: Ruhrbarone
.jpg) Foto: Archiv
Foto: Archiv