
86 Jahre liegt das Pogrom zurück, in Bochum erinnerten Schüler an einen, der seine Vernichtung überlebt hatte, Siegbert Vollmann. Er war zurückgekehrt in eine Stadtgesellschaft, die ihn ausgestoßen hatte. Hat er, der Vertriebene, ihr vertraut, nicht vertraut? Frage von Grigory Rabinovich, Stimme der jüdischen Bochumer heute: „Brüssel, Bochum, Amsterdam?“
Eine verunsicherte Gesellschaft, die sich am Vortag des 9. Novembers dort zusammenfand, wo einmal eine Synagoge gestanden hat in Bochum, beim Pogrom 1938 war sie niedergebrannt worden so wie rund 1400 Synagogen im Land. Im vergangenen Jahr, vier Wochen nach den Massakern der Hamas, hatten Bochumer den Platz, der den Namen von Otto Ruer trägt – ihn, den jüdischen Oberbürgermeister der Stadt, hatten die Nazis bereits 1933 in den Tod getrieben – recht gut gefüllt, ein Jahr später ist nur etwa jeder Dritte noch gekommen. Stunden zuvor waren Juden – israelische Fußballfans – durch die Straßen von Amsterdam gehetzt worden, mit dem Auto sind es 2 ½ h dorthin, was bedeuten 2 1/2 Stunden im Vergleich zu 86 Jahren.
Wer solche Zeiten zusammendenken musste, war Grigory Rabinovich, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen und damit Nachfolger von Siegbert Vollmann (1882 – 1954), an den die Schüler des Louis-Baare-Berufskollegs erinnerten – in Bochum wird der 9. November Jahr für Jahr von schulischen Initiativen erinnert, „von vielen Schulen“, wie Bochums OB Thomas Eiskirch (SPD) in seinem Grußwort erwähnte, „es könnten mehr sein“. Vollmann hatte, weil christlich verheiratet, den Terror der Nazis überlebt und war zurückgekehrt in eine Stadtgesellschaft, die sich von der, die sie eben noch war, kaum erkennbar unterschied. Das Kaufhaus Alsberg (oben im Bild), in dem Vollmann als leitender Angestellter beschäftigt gewesen war, heißt heute „Kortum“ wie damals, als das Haus „arisiert“ und die Alsbergs ermordet worden waren. Und doch hat Vollmann unmittelbar ab 1945 – zusammen mit Alfred Salomon (1919 – 2013), der hatte selbst Auschwitz überlebt – wieder eine kleine jüdische Gemeinde in Bochum gegründet. „Ein Geschenk“, so Eiskirch.
Eines, das jetzt ausgerechnet in Amsterdam durch die Straßen getreten worden ist, der Stadt, in der sich 1940 der Widerstand gegen die Nazis und eine elementare Solidarität mit den niederländischen Juden formiert hatte: „Die Judenpogrome sind ein Angriff auf die gesamte arbeitende Bevölkerung!“ hatte die Kommunistische Partei im Februar 1940 aus dem Untergrund heraus gerufen: „Staakt!!!“ Streikt! „Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!!“ Der Aufruf hatte sich tagesschnell zum Generalstreik geweitet, von der Stadtgesellschaft getragen, von den Nazis niedergeschossen. Hunderttausende Niederländer hatten während der Nazi-Zeit bis zu 350 000 Verfolgte versteckt, untern ihnen etwa 25 000 Juden, eine von ihnen Anne Frank, sie wurde 761 lange Tage geschützt – für deutsche Landen liegen nicht annähernd ähnelnde Zahlen vor. Jüdischen Fußballfans hatten guten Grund, Amsterdam als vergleichsweise sicheren Ort zu sehen, immer wieder in den vergangenen Jahren waren die Fans von Ajax, dem Amsterdamer Cub, selber antisemitischen Attacken ausgesetzt. Es hätte, so schien es, zu einer friedvollen Reise werden können für die Fans von Maccabi Tel Aviv gerade auch im Vergleich zu einer Reise ins benachbarte Belgien, dort haben sich die staatlichen Sicherheitsbehörden – auch dies nur 2 1/2 Autostunden von Bochum entfernt – glattweg unterworfen: Weil sie sich für die Sicherheit israelischer Fußball-Teams nicht mehr engagieren mochten, werden entsprechende Spiele von Belgien ab jetzt nach Ungarn verlegt.
„Amsterdam, Brüssel, Bochum, ich kann nichts mehr ausschließen.“
Grigory Rabinovich sprach frei, als er zu der Bochumer Stadtgesellschaft sprach, zu jenem Drittel, das daran erinnerte, wofür der 9. November steht: dass sich jeder entscheiden kann. Vor einem Jahr hatte Eiskirch die Kulturinstitutionen der Stadt – alle, die öffentlich gefördert werden – sowie die Einrichtungen der Wissenschaft aufgerufen, sich in aller Erkennbarkeit gegen Terror und Judenhass zu stellen, gegen Hamas und deren Geschwall von „Widerstand“. Dieser Appell sei ihm von vielen übel genommen worden, berichtete Eiskirch der Stadtgesellschaft jetzt: Manche von denen, die sich gemeint gefühlt haben, hätten auf ihre vielfachen Aktivitäten verwiesen – Eiskirch führte keine einzige an – , andere hätten sich „ertappt gefühlt“.
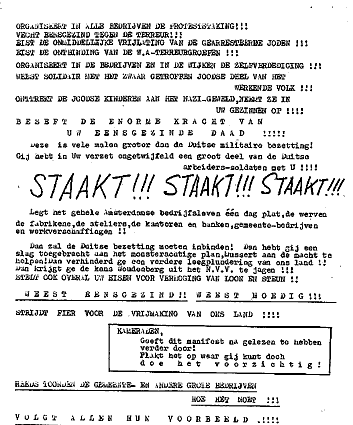
Was also lässt sich ausschließen in Bochum, was nicht mehr? Kultureinrichtungen gehen voran, dies zumindest das Selbstverständnis der öffentlich geförderten, sie geben sich selber als gesellschaftliche Avantgarde, gerne auch als Visionär, kürzlich wollte der Bahnhof Langendreer antisemitische Bilder ausstellen, knallharte Hamas-Ideologie, man wolle, hieß es, zur Diskussion einladen. Als sei es erneut an der Zeit, das Für und Wider von Judenhass zu erwägen. Ratsfraktionen und Verwaltung reagierten eindeutig und prompt, ähnlich prompt hat der Bahnhof seine irre Idee drangegeben – mit Ressentiment allerdings, wer von Staatsknete lebt, inszeniert sich beharrlich als Opfer des Staates – , die Episode insgesamt hat das Vertrauen in Rat und Verwaltung gestärkt. Aber auch das Vertrauen, das eine Stadtgesellschaft in sich selber setzen müsste, um sich auf sich selber verlassen zu können?
Der Test könnte bald anstehen. Seit Jahren ist Bochum neuen Städtepartnerschaften gegenüber verschlossen, hat sich jetzt aber der NRW-Initiative „Shalom Chaveruth“ angeschlossen, die in unmittelbarer Reaktion auf 10/7 eine engere Zusammenarbeit mit Israel auf Ebene der Städte anbahnen will. „Gerade jetzt“ und gerade dort, wo der Terror gewütet hat. Bochum, berichtete Eiskirch zum Gedenken an den 9. November, stehe im Austausch mit Sderot, der Stadt im Süden Israels, die näher an Hamas-Land liegt als Essen an Bochum. Eine solche Partnerschaft – Sderot ist keine Großstadt, ihre Einwohnerschaft könnte das Ruhrstadion füllen – hat schon deshalb Sinn, weil sich dann endlich in jedem öffentlich geförderten Raum in Bochum die Israelfahne aufziehen ließe. Eine Vorstellung, die keinen Hass jemals hemmen wird, wohl aber die gute Laune verderben dürfte, die BDS verbreitet, jenes Schulterschlagen, das in „israelkritischen“ Milieus zum Habitus zählt, weil sich die Moral nur so in die eigenen Klamotten klopfen0 lässt.
Ob dann, wenn eine kleine Israelfahne hinge im Ticketshop, der Ticketverkauf einbrechen könnte dort, wo Kultur mit städtischen Mitteln gefördert wird? Ob es arg viele Kulturakteure wären auf der Bühne oder davor, die einen Bogen machten um Bochum?
Es bleibt bedrückend, dass, soweit bekannt, in keiner Bochumer Kultureinrichtung nach 10/7, dem barbarischen Massaker an einer Demokratie, auch nur einmal die Hatikwa gespielt worden ist, die israelische Hymne, so wie die ukrainische Hymne zumindest an manchen Kulturorten im Land gespielt worden ist, als Putin damit begonnen hatte, eine weitere Demokratie zusammenzuschießen.
Wenn nun die Kultureinrichtungen einer Stadt, „wo das Wir noch zählt“, wie es in deren Stadtmarketing heißt, wenn sie alle die Israelfahne hissten, wer von den Bochumer Vereinen und Gemeinden, den Firmen und Händlern, den Initiativen und gGmbHs, den Leuten wie du und ich täte es ihnen gleich? Wer von „Wir“?
Niemand am vergangenen Freitag auf dem Otto-Ruer-Platz hat diese Frage gestellt, als es, 86 Jahre danach, „gegen das Vergessen“ ging, weil klar ist, sie stellt sich von selbst. Die Verunsicherung war zu spüren: Eine Stadtgesellschaft, auf die Bühne fixiert, schaute gleichsam über ihren Rücken, als sie zusammenfand, um an das jüngste Pogrom in dieser Stadt zu erinnern. Allein Grigory Rabinovich hat diese Verunsicherung benannt, die der Juden, die sich nicht sicher fühlen können, weil ohne Unterlass bedroht.
Woher die Unsicherheit der anderen?

