
Dies ist ein Auszug aus dem neuen Buch von Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft bei WELT, über den Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft: „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten – der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft“
Die britische Königin Elisabeth II. posierte 1961 zusammen mit ihrem Gemahl und einer Jagdgesellschaft in Indien vor einem erschossenen Tiger. Prinz Philip war Präsident des World Wide Fund for Nature (WWF), den er gerade zusammen mit anderen Adligen und Reichen gegründet hatte, darunter Prinz Bernhard der Niederlande und Godfrey A. Rockefeller. Im »Morges-Manifest«, dem Gründungstext des Umweltverbands, versprach der WWF, sich für Wildtiere einzusetzen: »Überall auf der Welt verlieren heute unzählige feine und harmlose Wildtiere ihr Leben oder ihre Heimat in einer Orgie der gedankenlosen und nutzlosen Zerstörung.«
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Indien rund 100 000 Tiger, mittlerweile sind es nur noch wenige Tausend. »Natürlich habe ich vor, wenn möglich einen Tiger zu schießen, warum nicht?«, zitierten Medien Prinz Philip bei seinem Besuch in Südostasien 1961. Etwa 200 Treiber hatten die Raubkatzen auf eine Lichtung in die Nähe eines erhöhten Holzturms gescheucht, von wo aus der Herzog eine von ihnen mit einem Kopfschuss tötete. Der Leichnam wurde per Lastwagen zum Palast des Maharadschas in Jaipur transportiert und dort von Würdenträgern umringt fotografiert, darunter der stolze Prinz und die Königin.
Am folgenden Morgen organisierten die adligen Gastgeber für die Königin eine Jagd, damit sie einen weiblichen Tiger erlegen konnte. Laut einer Begleiterin habe sie ihre Waffe für den tödlichen Schuss einem ihrer Mitarbeiter übergeben. Der Maharadscha ließ den Trophäentiger des Prinzen häuten, ausstopfen und nach Windsor Castle verschiffen. Philip soll noch zwei Krokodile getötet haben, eines fünf Meter lang. Der damalige britische Außenminister Alec Douglas-Home, der die Royals begleitete, habe ein seltenes weibliches weißes Nashorn geschossen, meldeten Medien. Prinz Philip beugte sich schließlich dem öffentlichen Druck und gab die Großwildjagd auf, aber er verteidigte sie weiterhin: Man töte nicht, man keule.
Der Schutz von Wildtieren ging einher mit dem Schutz von Jagdrevieren der High Society. Dekolonialisierung und Bevölkerungswachstum bedrohten Afrikas Tierwelt, so die Sorge adliger Großwildfreunde. Mit dem WWF vergrößerten Reiche ihren Einfluss. Der »1001-Club«, gegründet Anfang der 1960er-Jahre von Prinz Philip und rund 1000 überwiegend anonymen Wohlhabenden, unterstützte den Umweltverband. Das investigative Schwarzbuch WWF bezeichnete den verschwiegenen Verein als Netzwerk »alter Jungs« mit weltweitem Einfluss in Politik und Wirtschaft: Baron von Thyssen, der Fiat-Chef Gianni Agnelli, Autofirmen-Boss Henry Ford, Bier-Magnat Alfred Heineken, der dubioser Geschäfte verdächtigte Politiker Mobutu Sese Seko aus dem damaligen Zaire und der ehe-malige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Juan Samaranch.
Der WWF konnte durch das Gewicht seiner Mitglieder Nähe zu Regierungen aufbauen. Anfang der 1990er-Jahre erhielt seine deutsche Zweigstelle rund die Hälfte ihrer Mittel von der Bundesregierung und diversen Hilfsorganisationen. Gleichzeitig verdiente der WWF Geld mit seiner Marke: »Wildlife-Taschentücher« mit dem bekannten Panda trieben den Umsatz der Papiertücher-Marke Kleenex um 76 Prozent nach oben. Das Geschäft lohnte sich: Der WWF zahlt seinen Angestellten mittlerweile Gehälter wie ein Spitzenunternehmen; die Chefs verdienen rund eine Million US-Dollar pro Jahr, hohe Angestellte viele Hunderttausend. Seine Filialen befinden sich in bester Lage beliebter Großstädte und sind mit dem Wort »pompös« zurückhaltend beschrieben. Trotz seines zur Schau gestellten Wohlstands freut sich der WWF jährlich über hohe Spendeneinnahmen und millionenschwere Zuwendungen aus Steuergeldern.
Umweltverbände dienten der alten Elite im Kampf um ihren Status. Der Westen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen dramatischen Aufschwung erlebt, die Bundesrepublik Deutschland feierte ihr Wirtschaftswunder. Altes Geld wie der Adel stemmten sich gegen die neureichen Emporkömmlinge. Bürger genossen den Besitz von Waschmaschine, Kühlschrank und Fernseher; »Wohlstandsbäuche« verrieten die ungewohnte Freude an üppigem Essen. Mit eigenem Haus und Auto sowie dem Urlaub im Süden entkamen die Deutschen den Trümmern des Krieges, binnen dreier Jahrzehnte gelang der Aufstieg zur drittstärksten Wirtschaftsnation nach den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die USA versiebenfachten ihre Wirtschaftsleistung zwischen 1945 und 1975, als das Land mehr als ein Drittel der weltweiten Industrieproduktion stellte. Vielen Millionen Bürgern gelang der Aufstieg in die Mittelschicht, der »amerikanische Traum« wurde wahr.
Neue Eliten entstanden: Unternehmer, die mit ihrer eigenen Firma Geld gemacht hatten, sowie ihre Angestellten und Fachkräfte, die ebenfalls ihren Wohlstand zeigten. Die Konkurrenz sorgte für Argwohn beim Establishment: Adlige, Erben, Intellektuelle, Beamte, Journalisten, Lehrer und Künstler fürchteten die Rivalen im Kampf um gesellschaftliche Anerkennung. Deshalb spannten sie die Umweltbewegung für den neuen Klassenkampf ein. Die Befürwortung antikapitalistischer Werte ermöglichte es ihnen, zumindest dem Anschein nach gar nicht mit den wirtschaftlich Erfolgreichen konkurrieren zu wollen, weil sie deren grundlegende Überzeugungen ablehnten.
Um sich parallel auch nach »unten« abzugrenzen, knüpfte man die eigenen Werte an gewisse Kosten: Essen, Energie, Transport, das Leben allgemein musste teurer werden für ein Ziel: Umweltschutz – eine Haltung mit Tradition, wie von John Carey in The Intellectuals and the Masses dokumentiert: Die literarischen Snobs des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts hatten bereits in ähnlicher Weise auf die Industriegesellschaft und die Massenproduktion herabgeblickt wie die Eliten der 1960er-Jahre. Schriftsteller des Fin de Siécle spotteten über die Konsumkultur und beklagten »den Kollektivismus der industriellen Welt« mit seinen »riesigen mechanisierte Massen«. Sie träumten von einer Zukunft, in der »die Minen geschlossen, die Häuser abgerissen und die Obstgärten neu gepflanzt werden«, und sehnten sich nach einer »unschuldigen, vorindustriellen Existenz«. Ein gutes halbes Jahrhundert später wiederholte die frühe moderne Umweltbewegung jene Abgrenzungsbemühungen der Schickeria.
Die schwedische Familie Thunberg, eine wohlhabende Künstlerdynastie aus Schauspielern, Musikern und Filmemachern, gehört nicht nur im weltweiten, sondern auch im nationalen Vergleich zu den Wohlhabenden. Greta Thunberg, Ikone der modernen Klimabewegung, wurde als Teenager berühmt, weil sie nicht zur Schule gegangen war und stattdessen wegen der globalen Erwärmung »gestreikt« hatte. 2022 verriet sie einem Publikum in London, dass Klimaaktivisten »das gesamte kapitalistische System« stürzen müssten, weil es für Imperialismus, Unterdrückung, Völkermord und Rassismus verantwortlich sei. Doch hatte das »gesamte kapitalistische System« nicht nur der Familie Thunberg über mehrere Generationen ein kommodes Leben als Künstler ermöglicht, sondern auch bewirkt, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen auf der Erde mehr als verdoppelte. Dabei produzierte es größere Nahrungsmittelüberschüsse als jede andere Gesellschaftsordnung in der Geschichte. Ironischerweise hat ihr »Widerstand« den Spitzenstatus ihrer Familie in der kapitalistischen Gesellschaft gefestigt: Die Thunbergs sind berühmt geworden. Sie hatten es leicht. Unternehmer, Arbeiter, Angestellte und ihre Familien konnten keine kraftvolle Gegenerzählung heraufbeschwören – es gab keine Kampagne für den Kapitalismus, der doch dafür gesorgt hatte, so viele Menschen wie nie zuvor aus der Armut zu befreien.
»Antikapitalismus ist das am meisten verbreitete und überall praktizierte ideelle Bekenntnis unter Intellektuellen«, urteilte auch der amerikanische Historiker Alan Kahan. Als Menschen, die von Berufswegen komplexe Gedankensysteme ersinnen, verteidigen sie mit der Kritik am Kapitalismus, eines Systems spontaner Ordnung, ihre eigene Zunft. Sie ersinnen Utopien, welche die Mängel der Marktwirtschaft durch staatliche Steuerung beheben sollen. Die Ursache für diese Haltung sah der Philosoph Robert Nozick in der Schule, wo intellektuelle Qualitäten belohnt werden: Die Enttäuschung über das wahre Leben führe später zu Frustration, und diese liefere eine Begründung für die Affinität von Intellektuellen für antikapitalistische Ressentiments.
»Die alten Reichen hassen den Kapitalismus, weil er die Kluft zwischen ihnen und den neuen Reichen verringert«, schreibt der Umweltaktivist Michael Shellenberger, den das Time Magazine 2008 zum »Hero of the Environment of the Year« (»Umweltheld des Jahres«) kürte. Er kritisiert sogenannte Philanthropen, Erben von Milliardären wie der Rockefeller-Familie, die Kampagnen gegen Fracking finanzieren, weil dieses schlecht für das Klima sei. »Es war immer offensichtlich, dass Fracking durch die Schaffung von billigem und reichlich vorhandenem Erdgas als Ersatz für Kohle die Emissionen reduzieren und großartig für die Umwelt sein wird«, sagt Shellenberger. Der wahre Grund, warum die Erben der Milliardäre gegenläufige Zeile verfolgten, sei, dass Fracking ihren wirtschaftlichen Reichtum, ihren sozialen Status und ihre politische Macht bedrohe. Mehr Öl und Gas bedeute mehr Geld für marktwirtschaftliche Republikaner als für »Knappheitsdemokraten« und »dass die alten Reichen den neuen Reichen in sozialen Kreisen weichen müssen«, so Shellenberger.
Im Dezember 2023 landete der britische König Charles mit seinem Privatflugzeug auf der UN-Klimakonferenz in Dubai, wo er die reichen Herrscher der örtlichen Stammesautokratie traf, um in klimatisierten Gebäuden, errichtet von armen Asiaten und Afrikanern in gefährlicher Hitze, vor der globalen Erwärmung zu warnen und das Verbot fossiler Energie zu fordern. Charles hatte 176 Monate vor der Dubai-Konferenz gemahnt, dass nur »100 Monate« blieben, um den Planeten zu retten. »Die industrielle Revolution war ein herber Schlag für die Aristokraten«, kommentiert der Journalist Brendan O’Neill. »Die gewaltsame Verwandlung Großbritanniens von einer Agrar- in eine Industriewirtschaft raubte den alten Blaublütern einen Großteil ihres wirtschaftlichen Vorteils und ihres alltäglichen Einflusses.« Es gebe eben einen Grund, warum der britische Umweltschutz »von wütenden, vornehmen Menschen überrannt wird«.
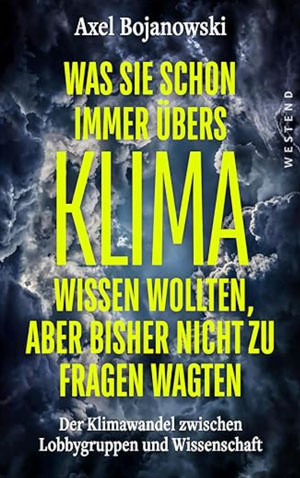 Axel Bojanowski: „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher
Axel Bojanowski: „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher
nicht zu fragen wagten – der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft“
Westend-Verlag, 288 Seiten, 25 Euro
Bei Amazon bestellen

