
Im zweiten Teil meiner Serie über Psychopharmaka will ich darüber sprechen, wie man Nutzen und Risiken abwägt. In Teil 1 ging es um allgemeine Wirkprinzipien.
Immer nur Pillen schlucken
Ich würde eine Wette eingehen, dass viel mehr Menschen eine Meinung zu Psychopharmaka haben als meinetwegen zu Blutdruckmitteln. Psychopharmaka lassen niemanden kalt. Und dafür gibt es gute Gründe.
Wieso wird nicht so leidenschaftlich über Beta-Blocker diskutiert wie über Antidepressiva? Es nehmen ja sehr viele Menschen Blutdruckmittel. Überhaupt nehmen sehr viele Menschen Medikamente (oder bekommen sie von ihrem Arzt empfohlen – viele bleiben ja ungeschluckt): Um die 70% der Versicherten kriegen pro Jahr wenigstens irgendein Mittel verschrieben. Ungefähr ein Viertel der Menschen bekommt Medikamente für den Kreislauf. Gar nicht viel weniger erhalten Mittel für das „Nervensystem“, also auch für die Psyche. Es ist also absolut angemessen, sich anzuschauen, was Millionen von Menschen da Tag für Tag mit ihren Körpern tun, wo sie sich durch Medikamente schaden, wo sie sich durch das Vergessen von Medikamenten schaden, wo sie Wechsel- und Nebenwirkungen haben und wo noch viel mehr Menschen geholfen werden könnte, wenn sie die richtigen Mittel nehmen würden.
Aber wenn Medikamente das Denken und Fühlen beeinflussen und noch dazu auf Zustände zielen, die manchmal gar nicht so leicht zu definieren sind, wenn sie gegebenenfalls unter Zwang oder wenigstens psychischem Druck verordnet werden, dann ist eine besonnene Abwägung schwerer, als bei einem Kreislaufmedikament. Ich will daher mit dieser Serie dazu beitragen, dass eine aufgeklärte und selbstbestimmte Abwägung möglich wird.
Nehmen oder Nicht-Nehmen?
Wenn ein Patient einen Psychiater aufsucht und um Hilfe bittet (und entgegen mancher Schreckensbilder von Zwang und Bevormundung ist das in den allermeisten Fällen so), muss es eine rationale Grundlage geben, auf der die beiden sich für eine bestimmte Behandlung entscheiden. Eine medikamentöse Therapie kann aussichtslos sein, kann trotz zu erwartender Wirkung kontraindiziert sein (also wegen Begleiterkrankungen unmöglich) oder kann dringend geboten bis zwingend erforderlich sein. Folgende Fragen müssen sich Arzt und Patient stellen, um zu einem Ergebnis zu kommen:
- Welchen Nutzen hätte das Medikament?
- Welchen Schaden kann es anrichten?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass der Nutzen oder der Schaden eintreten?
Frage drei ist wichtig. Wenn ich in den Urlaub fliege, weiß ich, dass der mögliche Schaden – ein Flugzeugabsturz mit Todesfolge – für mich alles vernichtend wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er eintritt, ist nun mal so gering, dass ich bereit bin, dieses Risiko für den Nutzen (den Urlaub) einzugehen.
Umgekehrt, um wieder medizinischer zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Chemotherapie erheblichen Schaden anrichtet und sehr unangenehme Nebenwirkungen verursacht, hoch. Da sie aber eventuell die einzige Möglichkeit ist, das Leben zu retten, nehmen viele eine solche Behandlung in Kauf. Aber, und da kommen wir zu meinem wichtigsten Punkt für diesen Artikel: Genauso kann es sein, dass ein Krebspatient sagt, die Chance auf Heilung ist so gering, dass er die Strapaze der Chemotherapie nicht auf sich nehmen will. Der Preis ist ihm zu hoch, obwohl es vielleicht sein Leben retten könnte. Diese Entscheidung kann er nur selbst treffen. Aber er braucht dafür gute Informationen durch seinen Arzt, der ihm sagen muss, wie gut die Chancen stehen, dass die Behandlung anschlagen würde und wie schwer die zu erwartenden Folgen sind.
Leider ist es bei der Behandlung psychischer Erkrankungen oft schwer vorhersehbar, welches Mittel wie gut hilft. Versuch und Irrtum sind an der Tagesordnung. Es braucht daher einen Arzt, der sehr genau hinhört, der die Wirksamkeit seiner Verordnungen kritisch beobachtet und bereit ist, etwas zu verändern, sobald erforderlich.
Es lassen sich auch nicht alle Erkrankungen gleich gut behandeln und das ist eine Wahrheit, die nicht alle Kollegen gerne hören. Denn natürlich gibt es diese Psychiater, die wenig Zeit haben (aufgrund äußerer Bedingungen) oder sich wenig Zeit nehmen wollen (aufgrund innerer Bedingungen) und die gerne alles schnell mit einem Medikament abbügeln wollen. Wenn der Patient es nicht nimmt – selber schuld, dann kann man ihm eben nicht helfen. Aber ich halte es für einen Fehler, die Kritik an dieser Art von Umgang mit einer Kritik an den Medikamenten selbst zu vertauschen.
Nutzen
Bevor man abwägen kann, ob die Risiken den Nutzen wert sind, muss man wissen, wie dieser Nutzen aussieht. Ich werde auf die Wirkungen der einzelnen Substanzgruppen in späteren Teilen genauer eingehen. Aber ich will an dieser Stelle sagen, dass es auch hier weder Schwarz noch Weiß gibt. Es gibt kein Allheilmittel für psychische Krankheiten. Weder gibt es für jede Diagnose ein Medikament, noch wirken die Mittel bei jedem Patienten gleich gut.
Antipsychotika, also Mittel gegen Psychosen (auch Neuroleptika genannt) sind im Allgemeinen recht wirksam. Jedenfalls gegen bestimmte Symptome einer Psychose. Es gibt einen Anteil an Patienten, bei denen die Mittel wirkungslos sind, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Beschwerden wie Stimmenhören oder Gedankeneingebungen höchstwahrscheinlich weggehen werden, wenn man ein Antipsychotikum nimmt. Damit ist nicht alles gut und auf die damit verbundenen Risiken gehe ich gleich ein. Aber ich denke, es ist wichtig, überhaupt erst mal festzuhalten, was wir mit den Psychopharmaka eigentlich erreichen können und was nicht.
Denn zum Beispiel bei den Depressionen sieht es schon anders aus. Es wird viel darüber diskutiert, wie gut Antidepressiva wirken oder ob überhaupt. Derzeitiger Stand der Forschung ist: Sie wirken ein bisschen. Im Schnitt helfen sie mehr als ein Placebo, aber nicht durchschlagend gut. Für einen Menschen, der unter der drückenden Schwärze einer Depression leidet, kann diese Hilfe sehr viel sein. Zumal „im Schnitt“ eben nicht heißt, dass sie bei jedem wenig wirken, sondern bei manchen gar nicht und bei anderen viel. Es gibt im klinischen Alltag jedenfalls Patienten, denen es mit diesen Medikamenten rasch wieder gut geht. Ob das dann im Einzelfall ein Placebo-Effekt ist, kann man nicht wissen. Aber wenn es nach Stand der Forschung eine Wirkung gibt und man dann auch eine Wirkung sieht, würde ich sagen, es gibt gute Gründe, ein solches Mittel einzusetzen. Dennoch wäre ich bei einem kritischen Patienten zurückhaltender, für ein Antidepressivum zu werben, als für ein Antipsychotikum, einfach weil ich weiß, dass dessen Wirkung nicht so wahrscheinlich ist.
Es soll in dieser Reihe um Medikamente gehen, aber selbstverständlich gibt es andere Methoden, die unter Umständen vorzuziehen sind. Eine Psychotherapie zum Beispiel. Es gibt sogar viele psychiatrische Krankheitsbilder, etwa Persönlichkeitsstörungen, für die überhaupt keine Medikamente zur Verfügung stehen. Dort kann man allenfalls einzelne Symptome bekämpfen, aber was es vor allem braucht, ist eine Therapie.
Umgekehrt kann man aber auch nicht alle Zustände mit einer Psychotherapie (oder alleine damit) kurieren. Das Argument, man könne auf Psychopharmaka verzichten, wenn man sich nur die Zeit für die Patienten nehmen würde, halte ich für falsch. Abgesehen von dem logistischen Problem, dass wir derzeit einfach keinen Psychotherapieplatz für jeden haben, der ihn bräuchte, gibt es genügend Krankheitsbilder, die eine Psychotherapie unmöglich machen (zum Beispiel wenn ein Patient den Therapeuten für ein Alien hält und nicht mit ihm reden will), wo eine Psychotherapie aussichtslos ist (zum Beispiel bei einer Demenz) oder wo sie nicht gewünscht wird. Eine Psychotherapie erfordert aktive Mitarbeit. Und Zeit.
Es gibt auch andere Konzepte, wie Soteria, die jenseits der anspruchsvollen Bedingungen einer Psychotherapie hilfreich sein können. Aber häufig wird es nichts geben, was so schnell und so zuverlässig hilft, wie ein Medikament.
Es wird also nicht in jedem Fall einen großen Nutzen durch Psychopharmaka geben. Aber in vielen Fällen. Und es hängt von der Höhe dieses Nutzens ab, welche Risiken und Nebenwirkungen in Betroffener in Kauf nehmen sollte.
Risiken
In späteren Teilen werde ich ausführlicher auf die Nebenwirkungen einzelner Präparate eingehen. Hier will ich aber einige generelle Dinge erläutern. Wir Ärzte sprechen von „unerwünschten anderen Wirkungen“ (UAW). Warum so kompliziert? Weil es nicht immer eindeutig ist, welcher Effekt eines Medikaments erwünscht ist und welcher nicht.
Antidepressiva sollen beispielweise den Antrieb verbessern. Häufig leiden die Patienten aber zu Beginn der Behandlung unter einer unangenehmen Unruhe. Das liegt (jedenfalls nach meiner Interpretation) daran, dass der Antrieb schon gesteigert wird, der Betroffene aber noch immer freud- und interesselos ist. Er hat eine Energie, die noch ungerichtet ist, die er nicht kanalisieren kann. Ist nun die Besserung des Antriebs eine erwünschte Wirkung oder die Unruhe eine unerwünschte Nebenwirkung?
Ein anderes Beispiel: SSRI (Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, eine Sorte Antidepressiva) können als Nebenwirkung eine Orgasmusverzögerung verursachen. Allerdings werden genau diese Mittel genau deswegen auch zur Behandlung der Ejaculatio praecox, also des vorzeitigen Samenergusses eingesetzt. Die eigentliche antidepressive Wirkung ist hier nebensächlich, die Nebenwirkung ist die Wirkung.
Eine wichtige, sehr unangenehme UAW von konventionellen Neuroleptika, also altmodischeren Mitteln gegen Psychosen, sind die sogenannten EPMS. Hierbei handelt es sich um Bewegungsstörungen. Die Betroffenen führen unwillkürliche Muskelbewegungen durch, häufig im Bereich des Gesichts, oder sie haben Beschwerden, die einem Parkinson-Syndrom ähneln, also ein kleinschrittiges Gangbild, Zittern, verminderte Mimik.
Parkinson ist eine Erkrankung, bei der Nervenzellen, die über Dopamin kommunizieren, in einem bestimmten Bereich des Gehirns (nigrostriatales System) zugrunde gehen. Das heißt, dass dort zu wenig Informationsfluss über Dopamin stattfindet. Die Folge ist, dass die Bewegungen nicht so koordiniert werden können, wie sie sollten.
Neuroleptika hemmen das Dopamin (siehe Teil 1). Sie tun das im Falle der konventionellen Neuroleptika auch im nigrostriatalen System. Wenn man das Dopamin dort blockiert, hat man den gleichen Effekt, wie wenn die Zellen im Rahmen der Parkinson-Erkrankung untergehen. Das Medikament induziert also ein künstliches Parkinson-Syndrom. Der gewünschte Effekt der Dopamin-Blockade im mesolimbischen System (dem Informationsweg, der bei der Psychose überaktiv ist) führt in einer anderen Hirnregion zu einem unerwünschten Effekt. Die modernen („atypischen“) Neuroleptika setzen nur an den für die Psychose relevanten Hirnregionen an und sparen das nigrostriatale System aus. Deswegen machen sie normalerweise auch keine EPMS.
Im Übrigen gibt es auch den umgekehrten Fall. Zur Behandlung von Parkinson setzt man nämlich dopaminerge Mittel ein, also Medikamente, die wie Dopamin wirken. Damit bringt man den Informationsfluss im nigrostriatalen System wieder in Schwung. Bei einer Psychose hat man, wie gesagt, zu viel Dopamin-Aktivität an anderer Stelle. Und wenn man die Dopamin-Aktivität dort künstlich mittels Parkinson-Medikamenten hochtreibt, kann man welche Nebenwirkung auslösen? Psychosen.
Häufigkeit
Viele der Nebenwirkungen sind also erklärbar oder ergeben sich aus der Wirkweise eines Präparates. Andere sind noch unverstanden. Wichtig zu wissen ist, dass man nicht automatisch alle Nebenwirkungen eines Medikaments bekommt. Für viele mag das selbstverständlich sein, aber man muss es betonen. Denn ich erlebe oft, dass Patienten denken, alles, was im Beipackzettel steht, müssten sie auch erleiden. Dabei wäre ein solches Mittel, das zwangsläufig alle diese mitunter schweren Nebenwirkungen auslöst, ein gefährliches Gift und niemals zugelassen. Als Psychopharmaka eignen sich nur Medikamente, die üblicherweise gut verträglich sind. Wenn ein Patient unter Nebenwirkungen leidet, stimmt etwas nicht.
Die letzten beiden Sätze sind geeignet, Widerspruch auszulösen. Mir ist klar, dass es da draußen Viele gibt, die schlechte Erfahrungen mit Psychopharmaka haben und diese Mittel nicht vertragen haben. Das bestreite ich nicht. Aber ich sage, dass in diesen Fällen die Behandlung nicht ideal war. Vielleicht, weil die Behandlung schlecht war, vielleicht, weil die Bedingungen nichts anderes erlaubt haben.
Am Wahrscheinlichsten ist, dass die Dosis der Mittel zu hoch war. Denn UAW treten besonders häufig dann auf, wenn man zu viel von einem Mittel gibt. Auch wenn ein moderner Wirkstoff relativ gezielt an bestimmten Strukturen ansetzt, wird er bei hoher Dosis quasi „überschwappen“ und sich in Bereichen auswirken, in denen es nicht erwünscht ist.
Grund für eine zu hohe Dosis ist in den meisten Fällen die Sorge, nicht genug zu tun, bei einer Unterdosierung hinter seinen Möglichkeiten zu bleiben. Gerade im Krankenhaus, wo die Menschen oft in einem akuten Zustand mit großem Leidensdruck aufgenommen werden, sind hohe Dosierungen häufig. Und wenn jemand sehr gequält ist oder vielleicht sich und andere gefährdet, kann dieser Ansatz durchaus richtig sein. Dann ist jeder Tag, den der Mensch länger leidet, weil man zu zurückhaltend dosiert, inakzeptabel. Aber das entbindet freilich nicht davon, dieses Vorgehen kritisch zu hinterfragen und ich bin überzeugt, dass viel zu viele Patienten unnötig unter Überdosierungen und Mehrfach-Kombinationen leiden, selbst wenn sie nicht in einer Ausnahmesituation sind, die das vielleicht rechtfertigt.
Eine solche Ausnahmesituation, die es allerdings eigentlich nicht rechtfertigt, stellen auch jene Menschen dar, die auf die Mittel einfach nicht ausreichend ansprechen. Denn die Medikamente sind ja keine Wundermittel. Ohnehin lassen sich nicht alle Krankheitsbilder gleich gut behandeln (siehe oben). Aber auch bei gleicher Diagnose sprechen manche Menschen besser auf die Medikation an als andere. Bei jenen, wo einfach nichts hilft, wird oft aus Verzweiflung die Dosis erhöht und noch ein Mittel in Kombination hinzugegeben und noch eines. Im schlimmsten Fall löst man damit lediglich unerwünschte Wirkungen aus, ohne jeden positiven Effekt. Aber irgendwann weiß man gar nicht mehr, wie es dem Patienten ohne Medikation geht und man fürchtet, dass es nach Absetzen der Mittel noch schlimmer wäre. Was auch sein kann. Und was nicht selten tödlich sein kann. Denn bei aller begründeten Kritik an Überdosierungen und ärztlichem Verhalten soll man nicht vergessen, dass meine Kollegen und ich es oft mit sehr kranken Menschen zu tun haben.
Es kann also Gründe geben, warum eine hohe Dosis gegeben wird, manche davon rationaler als andere. Gründe dafür, dass der Arzt nichts von den Nebenwirkungen weiß, darf es meines Erachtens hingegen nicht geben.
Reden!
Denn natürlich ist es nicht immer mit der Dosis alleine getan. Nicht jeder verträgt jedes Mittel gleich gut und wir haben bislang keine Möglichkeit, das vorherzusagen. Es ist also immer möglich, dass jemand auf ein Mittel auch in niedriger Dosis mit Nebenwirkungen reagiert. Dann kommt es auf das offene Gespräch zwischen ihm und seinem Arzt an. Und ich denke, dass dies der wichtigste Punkt in all dem ist. Viele Ärzte reden ungern über die Nebenwirkungen, vielleicht, weil sie fürchten, dass der Patient dann erst auf die Idee kommt, das Mittel abzusetzen und sie mit ihrem Latein am Ende wären. Das ist abzulehnen.
Aber ich finde, man darf auch dem Patienten ein Stück der Verantwortung geben. Oft genug haben Patienten mir erzählt, dass sie mal beim Arzt waren, ein Mittel bekommen haben, es nicht vertragen haben und dann einfach nicht mehr hingegangen sind. Ob sie denn dem Arzt nicht gesagt haben, dass das Mittel nicht gut ist, frage ich dann. Nein, höre ich nicht selten zur Antwort.
Aber ich will klarstellen, dass es zuvorderst die Aufgabe des Psychiaters ist, eine Atmosphäre herzustellen, in der der Patient sich auch animiert fühlt, so etwas zu berichten. Dann kann man gemeinsam abwägen. Ist es etwas Gefährliches? Ist es etwas, was üblicherweise nach ein bis zwei Wochen verschwindet (auch das ist nämlich nicht selten)? Und vor allem: Wie ist auf der anderen Seite die Wirkung des Mittels (oder manchmal die noch zu erwartende Wirkung)? Und schließlich: Wie bewertet der Patient diese erwünschte Wirkung im Verhältnis zur unerwünschten Wirkung?
Meistens kann man es mit einem anderen Mittel versuchen, wenn die Reduktion der Dosis nicht ausreicht. Aber nicht in jedem Falle ist das erfolgsversprechend. Und die Umstellung bedeutet wieder ein Risiko eines Rückfalles. Das kann man offen besprechen. Die Verantwortung trägt am Ende der Patient. Es ist seine Gesundheit. Wenn er sagt, diese Müdigkeit/diese sexuelle Funktionsstörung/diese Gewichtszunahme/… ist so einschneidend für meine Lebensqualität, dass ein Rückfall in die Krankheit auch nicht schlimmer wäre, dann sollte er das Risiko eingehen. Ich erlebe aber auch oft den umgekehrten Fall, bei dem Patienten sagen: Das Wichtigste ist, dass ich nicht wieder krank werde. Dann ist es sogar manchmal so, dass ich eine Umstellung oder Dosisreduktion empfehle und die Patienten sie ablehnen, weil sie kein Risiko eingehen wollen.
Kontrolle
Am Schluss will ich noch erwähnen, dass es eine Reihe von unerwünschten Wirkungen gibt, die gefährlich sein können, aber gut kontrollierbar sind. Das Gros der Nebenwirkungen ist eher harmlos, wenn auch unangenehm. In fast allen Fällen hören die UAW wieder auf, wenn man das Mittel absetzt. Da sie keine bleibenden Schäden hinterlassen, ist es vergleichsweise problemlos, es zu probieren und gegebenenfalls wieder zu beenden.
Allerdings gibt es einige UAW, die bedrohlich sein können. Unter anderem können viele Psychopharmaka (wenn auch selten) den Herzrhythmus verändern. Genau gesagt: die Erregungsleitung im Herzen. Noch genauer gesagt: die QT-Zeit im EKG verlängern. Insbesondere bei vorgeschädigten Herzen kann dies (im seltenen, aber dann lebendsbedrohlichen Einzellfall) zu Herzrhythmusstörungen führen. Deshalb macht man regelmäßig EKGs, um zu sehen, ob diese Veränderung besteht. Ebenso muss man das Blutbild und andere Laborwerte kontrollieren, weil hier gelegentlich Veränderungen auftreten können, die der Patient selbst nicht merkt, die aber gefährlich sein könnten. Hier gibt es feste Vorgaben und wenn man sich daran hält, ist das Risiko durch diese Nebenwirkungen gut unter Kontrolle.
Ein anderes Problem, das man eigentlich mit bloßem Auge sieht, das aber oft ignoriert wird, ist die Gewichtszunahme. Nicht wenige Psychopharmaka können sie auslösen. Viele Patienten nehmen zu und einige davon erheblich. Dieses Problem wird in letzter Zeit unter den Psychiatern sehr ernst genommen und diskutiert, denn die Einschränkungen dadurch sind natürlich erheblich. Neben all den medinizischen Problemen wie Diabetes mellitus etc. schränkt eine solche Adipositas auch gravierend die Lebensqualität ein und hindert die Menschen ihrerseits wieder an der Teilhabe. Es ist anfangs nicht immer leicht zu unterscheiden, ob jemand einfach an Gewicht zunimmt, weil er endlich wieder regelmäßig isst, weil er vielleicht in der Klinik andere Gewohnheiten verfolgt als zuhause (z.B. abends mit den Mitpatienten zusammmensitzen und noch etwas snacken) oder ob es sich um die gefürchtete Gewichtszunahme durch Medikamente handelt, die dann auch kaum mit Diät oder Willenskraft in den Griff zu kriegen ist.
Und auch hier wird wieder abgewogen. Endlich hat man etwas gefunden, was dem Menschen hilft; das vielleicht ansonsten gut vertragen wird. Man hat vielleicht die Hoffnung, dass der Patient später wieder abnehmen kann. Aber das fällt natürlich einem psychisch kranken Übergewichtigen auch nicht leichter als all den anderen Leuten. Die Ausgangslage kann so schlimm sein, dass die Gewichtszunahme das kleinere Übel ist. Aber sie ist ein hoher Preis. Wieder gilt: Der Patient muss entscheiden. Und vor allem muss er frühzeitig über das Risiko aufgeklärt werden und man muss von Anfang an das Gewicht kontrollieren. Vielleicht lässt er sich auf ein anderes Mittel umstellen, es ist ja nicht gesagt, dass dieses dickmachende Medikament das einzige ist, das ihm hilft.
In den kommenden Teilen will ich noch auf Wechselwirkungen und Abhängigkeit sowie die Zuverlässigkeit der Studienlage eingehen, bevor ich die einzelnen Medikamentengruppen vorstelle.

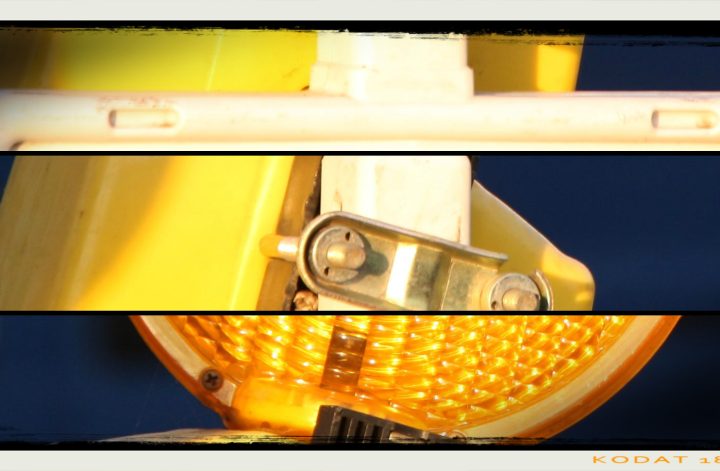
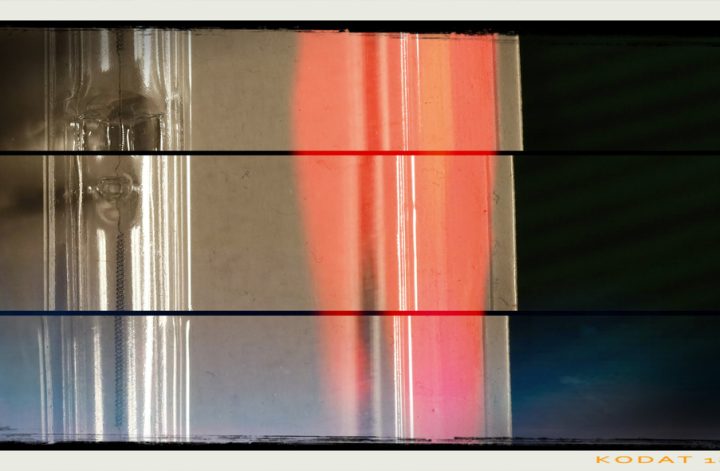

[…] die Frage, warum so viele Menschen mehrere Mittel gleichzeitig bekommen. Hier findet ihr Teil 1, Teil 2 und Teil […]
[…] für den Betroffenen sogar angenehm macht. Zur Abwägung von Nutzen und Risiken habe ich hier ausführlicher geschrieben. Zu wissen, ob der Patient die Mittel überhaupt nimmt, ist also für […]