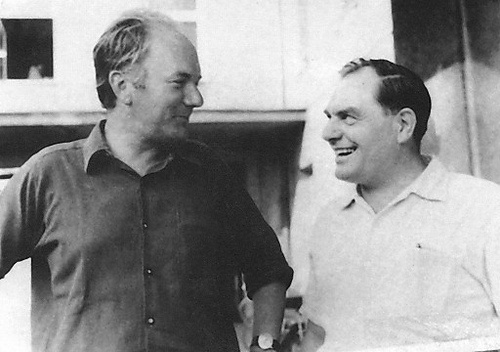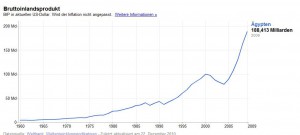Heute Abend ist es wieder so weit: Das Fräulein Julie spielt im Rottstr.5-Theater verrückt. Was passiert, wenn ein alter, Frauen hassender Schwede, Foucault und eine Rasierklinge aufeinander treffen? Kürzung in ihrer schönsten Form. Mit „Fräulein Julie“, einer Tragödie von August Strindberg, holt das Bochumer Rottstr5-Theater Herrschafts- und Geschlechterdiskurse auf die Bühne. Arne Nobel pflastert den strindbergschen Stände-Switch mit den wackeligen Steinplatten triebhaften Kalküls und naiver Begierden, bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Es ist der rasante Absturz in die Perspektivlosigkeit eines nimmergrünen Beziehungsgeflechts.
Weil der Lieblingswein von Strindberg und Michel Foucault Bier ist, trafen sie sich zu einem Sit-In in der Rottstr5. Strindbergs Tragödie von 1888 ist sein meist gespieltes Stück. Aber noch nie hat es eine Inszenierung gegeben wie jene, die aktuell im Rottstr5-Theater zu sehen ist: In einer postatomaren Zeit nach der Bombe wurde das feudale System revitalisiert. Ein bisschen Mad Max, aber immer noch Reclam. Mit Mut zur Klinge und Kürzung verhelfen Dramaturgie und Regie Strindbergs Klassiker zu appellativer Durchschlagskraft, mit der sich nahtlos an aktuelle Diskurse anknüpfen lässt.
Das Miteinander generiert sich orientierungslos. Im Wust aus Menschen, Geschlechtern, Hierarchien fällt es schwer, auf Augenhöhe unerschlossenes Land, ohne Gepäck aus der alten Welt zu betreten. Die Beteiligten hängen noch immer in und an den tradierten Herrschaftsverhältnissen und müssen einsehen: Ein Befehl klingt immer unfreundlich, auch wenn er auf den Wunsch eines anderen hin ausgesprochen wird.
Naturalistisches Küchendrama
Regisseur Arne Nobel ist dafür bekannt, dass er seinen Inszenierungen gerne ein gewisses Quantum Radikalität verpasst. Im Original liefert die Figurenkonstellation den Tod der Köchin nicht mit. Als Repräsentantin der gegebenen gesellschaftlichen Ordnung bildete sie ursprünglich das Gegengewicht zum sittenwidrigen Verhältnis von Julie (Dagny Dewath) und Jean (Andreas Bittl). Doch wird der Tod der Köchin in der Spielversion des Off-Theaters letztlich zur logischen Konsequenz dieses aufreibenden Küchendramas.

Monsieur Jean, der Knecht des Fräuleins, ist eigentlich verlobt mit Kristin, der Köchin des Hauses (Kerrin Banz). Er ist viel gereist, ein bisschen gebildet und deswegen überzeugt, er würde ihr als Verlobter nicht schaden. Gleichsam erwacht das Interesse der Herrin des Hauses an Jean, ihrem Untergebenen. Noch gilt, wenn sie befiehlt, muss er gehorchen. Jean will rauf und Julie will runter. Was folgt ist eine Nacht erotischer Verwirrung, eine Anleitung zum Unglücklichsein, ein naturalistisches Küchendrama. Das Setting der Story wird mithilfe des Bühnenarrangements komplettiert, in dem die Darsteller ständig ihre Plätze wechseln. Die Grenzen zwischen Ernst und Scherz, Hierarchie und Haltlosigkeit verschwimmen zunehmend.
Jean und Julie erobern einander, bezwingen und demütigen sich. Die Ebenen dieses kurvenhaften Emotionsverlaufs geraten ins Wanken, beinah wie bei Jean Genet wechseln ständig die Machtverhältnisse sowie ihre Maskeraden und plötzlich ist man mitten drin im Kampf um Herrschaft und Geschlechterverhältnisse. Fräulein Julie muss schon bald einsehen, dass sie nicht weiß, wie die Welt von unten aussieht. Jean und sie erahnen, aber unterschätzen die prägende Kraft der Klassenunterschiede. In der Sexszene der beiden sind ihre Körper auf ihre Silhouetten reduziert. Ihre Wirkmächtigkeit verdankt sie nicht zuletzt dem hervorragenden Einsatz des Lichts. Der Akt selbst ist kein wildes Rammeln, sondern entbrennt in stilvoller Körperästhetik hinter einem riesigen, halbdurchsichtigen Vorhang und verweist als Moment der Verschleierung auf die triebhaften Kräfte, die unter der sichtbaren Oberfläche der Zurückhaltung brodeln. Das Verlangen kulminiert in Begehren und entlädt sich im Akt. Die Entflammten bleiben nach der Apokalypse der Zweisamkeit in einer emotionalen Ruine zurück, bei der sich Drohung und Bedrohung abwechseln. Von Mäßigung, Halt und Orientierung sind sie weit entfernt.
Ruine eines Verlangens
Am Ende müssen Jean und Julie einsehen, dass es nicht reicht, „auf Purple Haze zu schlafen“, damit ihre Träume wahr werden. Beide ringen um Kontrolle, statt um Liebe. Sie will, dass er gut zu ihr ist. Er jedoch begreift nicht. Schließlich beschwert sich die hintergangene Köchin, sie wolle nicht länger in einem Haus wohnen, in dem man keinen Respekt mehr vor der Herrschaft hat. Ein Fehler. Am Ende kommt Solidarität nicht einmal unter den beiden Frauen auf, als Julie vorschlägt, man könne zu dritt fliehen. Nein, in diesen Verhältnissen verträgt man sich nicht.

Mittendrin findet sich die Darbietung einer großartigen Dagny Dewath, zwischen Dominanz und Geworfenheit und ein Andreas Bittl, der spielt als befände er sich in einem Rammstein-Video. Präzise zeichnen sie alle kaleidoskopischen Zersplitterungen der Emotionalität nach. Charmant richten sie einander mit ihren Worten und ihrem Spiel regelrecht hin. Dewath gelingt es mit der Intensität ihrer Mimik, alle Nuancen von Raserei, über Wut, bis hin zu quälender Verzweiflung zu erörtern, bis plötzlich sogar den Zuschauern die Tränen in den Augen stehen. Es gibt diese großen Szenen, in denen man ihr jede Regung, jedes Wort abnimmt. Alle Schauspieler verleihen dieser beeindruckenden Darbietung streckenweise ein geradezu erschütterndes Maß an Authentizität. Ihr leidenschaftliches Spiel straft die Wirklichkeit des Lebens als bloß verblassten Abglanz radikaler Emotionalität Lügen.
Am Ende geht es wie so oft um die verlorene Ehre. Sie fragt ihn, ob er wisse, was ein Mann einer Frau schuldet, die er entehrt hat. Er bedauert, dass das Gesetz nicht vorsieht, was mit einer Frau geschieht, die einen Mann verführt. Da waren sie wieder, die Geschlechterverhältnisse. Diese Inszenierung glänzt mit Aktualität, weil sie nicht bloß eine theatralische Lektion ist. Sie zeigt Ertrinkende auf dem Kampfplatz der Hierarchie, Scham und Schande, die noch immer keine antiquierten Zwangsvorstellungen sind.
Die nächste Vorstellung findet heute, um 19.30 Uhr statt.