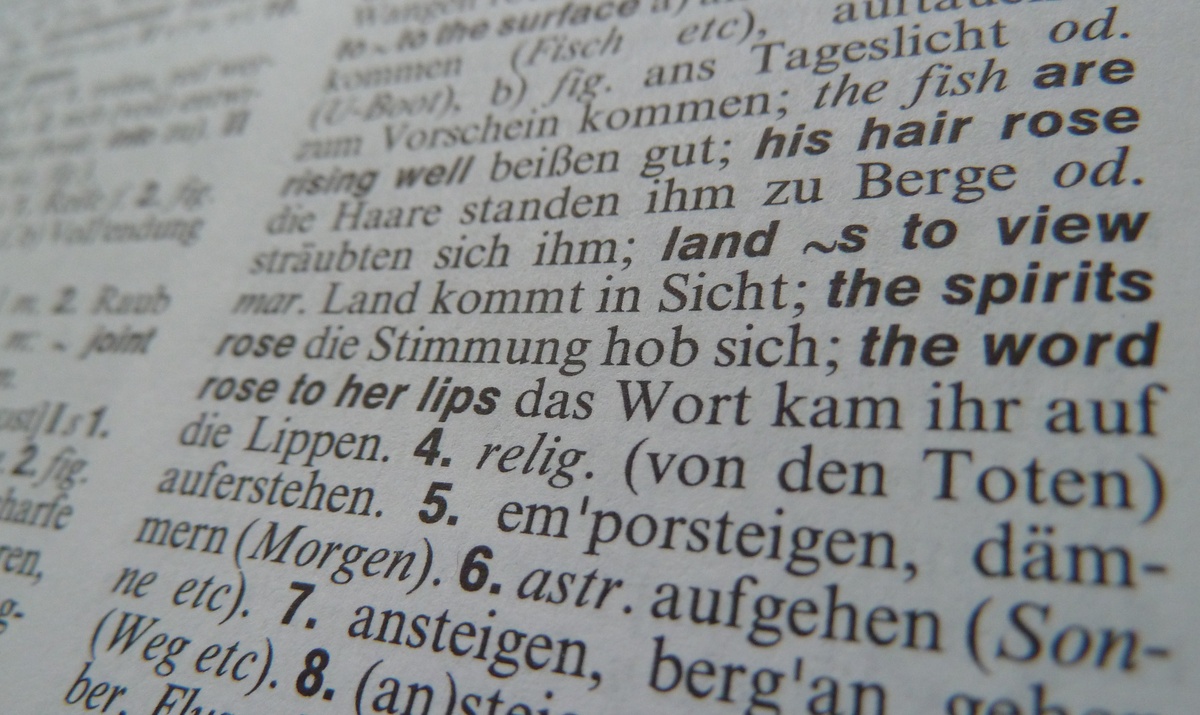Intendant Peter Carp verzahnt in einer Doppelpremiere am Theater Oberhausen Dennis Kellys „Waisen“ und Anton Tschechows „Drei Schwestern“ zu einem hundert Jahre überspannenden Diskurs über Familie. Von unserem Gastautor Honke Rambow.
Intendant Peter Carp verzahnt in einer Doppelpremiere am Theater Oberhausen Dennis Kellys „Waisen“ und Anton Tschechows „Drei Schwestern“ zu einem hundert Jahre überspannenden Diskurs über Familie. Von unserem Gastautor Honke Rambow.
Das Theater Oberhausen ist ein kleines Haus: 120 Mitarbeiter, 420 Plätze und ein knapper Etat, von dem in der aktuellen Spielzeit 750.000 Euro zusätzlich eingespart werden. Eigentlich Grund genug, um zu jammern. Doch seit Peter Carp vor zweieinhalb Jahren das Haus übernahm, benimmt es sich ganz wie ein großes. Das Schauspiel-Ensemble umfasst gerade mal 22 Personen. Bei den meisten Produktionen im großen Haus ist eher die Frage „Wer steht heute nicht auf der Bühne“. Dazu wird der Malersaal regelmäßig bespielt, Außenprojekte wie die des „Kunstlügners“ Hans Peter Litscher, „Peterchen‘s Mondfahrt“ im Gasometer und „Get Away!“ in einem leerstehenden Ladenlokal kommen hinzu. Und ganz selbstverständlich wird in Oberhausen international vernetzt, ohne dass daraus gleich ein Marketing-Claim oder ein Spielzeit Motto wie in anderen Theatern geschmiedet wird. Für Peter Carp war von Anfang an klar, dass auch eine kleinere Stadt wie Oberhausen mehr verdient als langweiliges Stadttheater-Repertoire – auch wenn das sicherlich oft einfacher wäre. Viel mehr überregionale Beachtung täte dem Haus bestimmt gut und hätte es verdient. Doch das gibt das deutsche Feuilleton nicht her. Kritiker wohnen halt lieber in Köln und da ist der Weg nach Oberhausen weit.
Jetzt hat am 14. und 15. Januar Peter Carp eine Doppelpremiere im großen Haus hingelegt. Ist das der endgültige Größenwahn? „Eigentlich zwingen uns die geforderten Etatkürzungen dazu, eine Produktion zu streichen“, erzählt der Intendant, „aber das wollten wir dem Publikum nicht zumuten.“ Die einzige Möglichkeit: zwei Stücke in der gleichen Zeit und im gleichen Bühnenbild zu proben. „Dazu kam, dass ‚Waisen‘ von Dennis Kelly ein Kammerspiel für drei Schauspieler ist, das allerdings unbedingt auf die große Bühne gehört. Ich wollte aber auch mit den anderen Schauspieler des Ensembles arbeiten.“ Das Ensemble und das technische Team ließ sich auf die ungewöhnliche Herausforderung ein – ohne zu wissen, ob es nicht eine Überforderung werden würde.
Ursprünglich war ein Doppelprogramm mit „Liebe und Geld“ – ebenfalls vom britischen Autor Dennis Kelly – geplant. „Irgendwann in der Planung stellten wir aber fest, dass das zwar ein gutes Stück, aber kein so brilliantes wie ‚Waisen‘ ist.“ Deshalb entschloss sich Carp als zweite Premiere seinen Tschechow-Zyklus mit „Drei Schwestern“ fortzusetzen – ein Klassiker, der die Herausforderung noch einmal verschärfte.
Die inhaltliche Klammer zwischen beiden Stücken ist, dass es um die Strukturen von Familie geht. In „Waisen“ ist es die moderne Kleinfamilie. Danny und Helen haben sich gut eingerichtet. Sie haben beide Jobs – was in London schon eine Leistung ist – einen Sohn, und Helen ist gerade wieder schwanger. Gerade haben sie sich zu einem entspannten Abendessen an den Tisch gesetzt – der Sohn ist bei der Oma ausquartiert –, da steht plötzlich Helens Bruder Liam in der Wohnung. Völlig mit Blut beschmiert. Warum? Das ist erstmal schwer aus ihm herauszubekommen. Er quatscht drauflos, aber die wichtigen Informationen kommen nur stückchenweise zu Tage und so richtig glauben mag das niemand, was Liam da erzählt. Während Helen versucht, von ihrem wegen einer Jugendsünde vorbestraften Bruder Probleme fern zu halten, will Danny einfach nur klären, was „da draußen“ vorgeht. Es ist wohl nicht das beste Viertel, in dem sie leben. Aber ihre Ängste vor der Außenwelt entstehen auch aus dem Übereifer, ihre eigenen schöne Welt zu schützen. Dass die gar nicht so heil ist, wie sie selbst glauben, zeigt sich immer mehr, je weiter sie in Liams Geschichte vordringen. Am Ende stehen sie vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung, aber auch das ignorieren sie beharrlich. „Mach es weg“, sagt Danny und meint das ungeborene gemeinsame Kind. Dann geht er raus. Helen bleibt einfach sitzen.
Dennis Kelly schreibt hier einen aufregenden Psychokrimi, der sich von einer Überraschung zu nächsten manövriert. Nach einer Viertelstunde glaubt der Zuschauer, er wüsste, wo es drauf hinausläuft, aber schon dreht sich die Geschichte wieder. Das ist alles sehr klug gebaut, aber wie so oft im angloamerikanischen Theater schaut manchmal auch die Konstruktion etwas zu deutlich durch. Trotzdem packt der Abend den Zuschauer über zwei Stunden. Das ist vor allem Martin Hohners Liam zu verdanken. Wie Helen und Danny lässt er auch den Zuschauer immer im Unklaren, was nun Lüge und was Aufrichtigkeit ist, er ist anstrengend, nervig und prollig, aber nie unsympathisch und fast ist man versucht, ihn in Schutz zu nehmen. Henry Meyers Danny ist ihm ein gleichwertiger Gegenspieler. Der rechtschaffende Bürger, der nur die Ordnung wieder herstellen will. Beide gehen mit der sehr artifiziellen Sprache des Stückes ganz selbstverständlich um. Dennis Kelly schreibt eine Umgangssprache, die oft aufs nötigste reduziert ist und in ihrer Bruchstückhaftigkeit hochmusikalisch. Damit hat Manja Kuhl, die mit der Helen die wichtigste, weil variabelste Rolle in diesem Thriller einnimmt, zunächst Schwierigkeiten. Ihr gelingt es nicht immer, sich diese Sprache zu eigen zu machen, einen Rhythmus zu finden.
Hundert Jahre früher, wieder eine Familie, diesmal eine sehr verzweigte. Und das Draußen ist nicht bedrohlich, sondern Sehnsuchtsort: Moskau, die große Stadt. Gerade in der Kopplung der beiden Stücke zeigt sich, wie irreal Vorstellungen von der Großstadt sind. Es sind bloß Bilder – die Realität ist wahrscheinlich eine ganz andere. Würden die drei Schwestern irgendwann wirklich nach Moskau gelangen, stellten sie vielleicht fest, dass es in Wahrheit Dennis Kellys London ist. Kaspar Zwimpfers Bühnenbild sieht an diesem zweiten Abend zunächst gar nicht so anders aus als die Wohnung von Helen und Danny. Ein paar Tapeten und Möbel sind hinzugekommen. Erst im Verlauf von „Drei Schwestern“ zeigt das Modulsystem seine enorme Wandlungsfähigkeit. Während Peter Carp sich in „Waisen“ darauf beschränkte, den Schauspielern Raum zur Entfaltung zu geben, zeigt er in „Drei Schwestern“ eine deutlich stärkere Regiehandschrift. Gleich zu Beginn macht er klar, dass es hier nicht um eine in Melancholie dahindämmernde russische Seelenlandschaft geht. Diese Familie balanciert am Rand der Hysterie und verfällt manchmal plötzlich in eine eisige Schockstarre. Zum Beispiel als Werschinin auftaucht. Der gutaussehende Mann aus Moskau, der die Sehnsüchte aktiviert. Jürgen Sarkiss verkörpert ihn perfekt, er ist ein Spieler, der weiß, dass er irgendwann wieder weg sein wird. Ganz selbstverständlich bricht er in diese Provinzwelt ein und scheint bewusst darüber hinwegzusehen, dass er sie eigentlich zerstört. Seine Schuld ist es nicht, marode war diese Familie auch schon vor seinem Eintreffen.
„Drei Schwestern“ zeigt in Oberhausen ein weiteres Mal, dass die Stärke des Hauses in seinem durchweg sehr guten Ensemble besteht. Elf Darsteller bestreiten dieses große Panorama, ohne dass einer gegen den anderen abfallen würde. Manja Kuhl zeigt sich als Mascha wieder ganz auf der Höhe, die Herren-Rollen sind bei Peter Waros als Baron Tusenbach, Martin Müller-Reisinger als Soljony, Klaus Zwick als Tschebutykin, Mohammad-Ali Behboudi als Anfissa in besten Händen. Anja Schweitzers Olga schwankt zwischen Grande Dame und verhärmter Jungfer und Angela Falkenhans Irina ist das Kind, das tragisch altert, ohne dabei recht erwachsen zu werden. Unmittelbarer als bei Martin Hohner und Henry Meyer, die wiederum Bruder und Ehemann von Manja Kuhl spielen, kann sich die Qualität eines Schauspielers aber kaum zeigen. Mit großer darstellerischer Lust zelebrieren beide ihre enorme Wandlungsfähigkeit. Nora Buzalka als Natalia allerdings, ist die Gewinnerin des Abends. Wenn sie nach der Pause von der geschmacklosen Provinz-Schnepfe zur Business-Zicke mutiert, übernimmt sie nicht nur das Haus der drei Schwestern, sondern auch die ganze Bühne. Sie ist ständig anwesend, modernisiert, baut um, dirigiert und macht alle anderen nur noch zu Positionen in ihrem Business-Plan. Am Ende verfrachtet sie die drei Schwestern in ihr frischeröffnetes Callcenter. Das ist ein radikales Bild, das Peter Carp da am Ende den Zuschauern vorsetzt. Das mag manchem Tschechow-Connaisseur zu viel Regie sein, aber anders als bei Carps „Kirschgarten“ geht es hier perfekt auf – auch, weil der Abend im Rhythmus klar darauf zusteuert und Carp noch mal einen drauf setzt und Henry Meyer als Karnevalsprinzen Kamellen ins Publikum schmeißen lässt. Radikaler Spaßradau, der die Tschechowsche Tragik brutal zuspitzt. In diesen „Drei Schwestern“ findet Peter Carp, der als Intendant von Anfang an Großartiges in Oberhausen geleistet hat, nicht nur enorm viele eindrucksvolle Bilder, sondern auch als Regisseur zu einer klaren Handschrift.
Das sind die Energien, auf deren Freisetzung Peter Carp hoffte, als er sich auf die Überforderung einer Doppelproduktion einließ. Das Experiment ist mehr als geglückt. Trotzdem wollte der Intendant das nach der Premiere nicht als Modell für die Zukunft sehen. Die Selbstausbeutung dieses Teams darf nicht zur Regel werden. Wohl auch ein Zeichen an die Politik, dass hier alles getan wird, um auch in einer finanziell maroden Stadt höchste Qualität zu liefern, aber weitere Einsparungen nicht ohne schwerwiegende künstlerische Verluste möglich sind.
 Das Djäzz in Duisburg steht vor dem Aus. Am kommenden Samstag wird dagegen demonstriert.
Das Djäzz in Duisburg steht vor dem Aus. Am kommenden Samstag wird dagegen demonstriert.