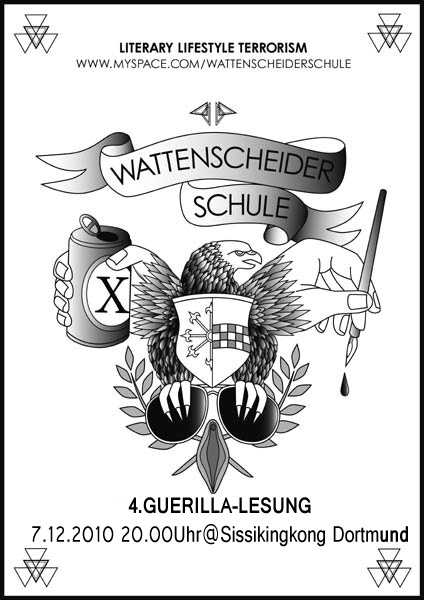Sie ist Deutsche mit Migrationshintergrund, Muslimin und alleinerziehende Mutter. Die 40jährige Betül Durmaz unterrichtet an der Malteserschule in der Neustadt in Gelsenkirchen, in der die meisten Schüler als sozial problematisch gelten. Sie ist die einzige Lehrerin mit einer Zuwanderungsgeschichte. Betül Durmaz hat ihr Leben und ihren Alltag in einem Buch aufgeschrieben. Herausgekommen ist dabei eine authentische Geschichte gelebter Integration. Der Name Durmaz heißt übersetzt: Die, die nicht stehen bleibt. Das Buch ist im Herder-Verlag erschienen und trägt den Titel „Döner, Machos und Migranten: Mein zartbitteres Lehrerleben“.
Sie ist Deutsche mit Migrationshintergrund, Muslimin und alleinerziehende Mutter. Die 40jährige Betül Durmaz unterrichtet an der Malteserschule in der Neustadt in Gelsenkirchen, in der die meisten Schüler als sozial problematisch gelten. Sie ist die einzige Lehrerin mit einer Zuwanderungsgeschichte. Betül Durmaz hat ihr Leben und ihren Alltag in einem Buch aufgeschrieben. Herausgekommen ist dabei eine authentische Geschichte gelebter Integration. Der Name Durmaz heißt übersetzt: Die, die nicht stehen bleibt. Das Buch ist im Herder-Verlag erschienen und trägt den Titel „Döner, Machos und Migranten: Mein zartbitteres Lehrerleben“.
Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden?
Vor zwei Jahren habe ich der Tageszeitung taz ein Interview über das Thema Rütli-Schule in Berlin gegeben. Daraufhin kam der Herder Verlag auf mich zu und hat angefragt, ob ich nicht ein Buch über das Thema Integration schreiben will. Am Anfang war ich etwas zurückhaltend, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass ein solches Thema viele Leser findet. Man musste mich schon dazu überreden.
Wie einfach war das Schreiben, ist es Ihnen leicht gefallen?
Andere Autoren wie Cornelia Funke schreiben ihre Bücher wahrscheinlich nachts in ihren Träumen. Ich habe mir ein Konzept überlegt und das dann umgesetzt. Das Schreiben selbst war ein Jahr lang harte Arbeit, und ich hatte ja auch keine Erfahrung damit. Den Titel hat der Verlag ausgesucht, um damit die Neugier der Leute zu wecken und möglichst viele Käufer anzusprechen.
Sind Sie deutsch oder wie würden Sie ihre Herkunft bezeichnen?
Meine Eltern waren die Gastarbeiter, ich bin kein Gast mehr und Deutschland ist mein Heimatland. Soziologisch verwendet man ja jetzt den Begriff „Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“. Ich lebe hier seit über 40 Jahren, Deutsch ist meine Sprache, die Türkei ist mein Urlaubsland und das Land meiner Vorfahren. Früher hieß es Gastarbeiter, dann hieß es Ausländer, dann Migranten und jetzt Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ich halte mich mit solchen Begrifflichkeiten nicht auf. Die „Entweder oder Zeiten“ sind einfach vorbei. Warum muss man sich für die eine oder andere Seite entscheiden? Klar gehöre ich zu Deutschland, aber genauso gut bin ich auch Türkin.
Was sind die größten Probleme, die eine gesellschaftliche Integration verhindern?
Bestimmte Ethnien sind hier überproportional vertreten. Die Kinder sind unter ihresgleichen, also unter Einheimischen. Die Amtssprache ist zwar im Unterricht Deutsch, aber das gilt natürlich nicht zum Beispiel für den Weg nach Hause. Die Ghettoisierung im Bildungswesen ist ein Grund dafür. Der zweite Grund ist: In Zeiten wirtschaftlicher Not besinnen sich die Menschen stärker auf ihre Religion. Wir haben es hier in der Schule auch mit sehr strenggläubigen Familien zu tun, wo Freundschaften mit deutschen Kindern kaum zustande kommen, und das wird von den Eltern auch nicht gepflegt. Die Schule ist der einzige Ort, wo sich Deutsche und Zuwanderer begegnen.
Was müsste konkret geändert werden?
Die meisten Kinder leben in ziemlich desolaten Verhältnissen und bekommen keine Förderung. Die Eltern sind oftmals überfordert und die Kinder sind die einzigen Familienmitglieder, die einen geregelten Tagesablauf haben. Wir haben es hier mit der zweiten und dritten Generation von Hartz-4-Empfänger zu tun. Die Lebensverhältnisse sind sehr beengt, es gibt viele Kinder in den Familien, der Fernseher läuft den ganzen Tag und da ist das Lernen für die Schule zweitrangig.
Ist es ein soziales Problem oder doch eher eins der unterschiedlichen Kulturen?
Wir haben es bei uns ausschließlich mit Kindern aus der Unterschicht zu tun. Das ist eindeutig ein soziales Problem, ein Milieuproblem. Dass die Migranten hier so stark vertreten sind, liegt natürlich an dem Stadtteil, in dem wir uns befinden. Ja, auch in der Neustadt ist eine Ghettoisierung zu beobachten, sie ist ein „Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf“. Das macht sich in der Schule bemerkbar, denn die gesamte Mittelschicht – auch die türkische – zieht hier weg. Die Politik hat das zugelassen und zu spät reagiert.
Ist die Religion ein Hindernis?
Der Islam steht der Bildung nicht im Weg. Es sind verschiedene Faktoren, die sich hier gegenseitig bedingen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchen die Menschen nach Halt in der Religion.
Wie kann die Schule hier helfen?
Wir vermitteln nicht nur Kulturtechniken, wie an anderen Schulen. Wir vermitteln sozial anerkannte Regeln und Werte, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit und den respektvollen Umgang mit den Mitmenschen. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Elternhauses. Wenn wir bei den einzelnen erfolgreich sind, dann sind das Bildungserfolge für uns. Der Arbeitsmarkt für Minderqualifizierte ist ja vollständig eingebrochen, aber mit uns haben einzelne vielleicht eine Chance auf die Beschäftigung im Niedriglohnsektor.
Warum werden so wenig Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Lehrer?
Die Regierung hat das ja gerade in ihrem Integrationsprogramm gefordert. Da kann man nur sagen „Guten Morgen“, denn in Fachkreisen ist das schon länger eine Selbstverständlichkeit. Man hat keine Sprachschwierigkeiten und kennt die kulturellen Hintergründe. Der NC für das Lehramt ist derzeit so hoch, dass viele Abiturienten ein anderes Studium vorziehen.
Sind Sie mehr Sozialarbeiter oder mehr Lehrer?
Zu 80 Prozent besteht meine Lehrertätigkeit aus Sozialarbeit.
Was müsste anders werden, um die Chancen der Kinder zu verbessern?
Die Schule muss so attraktiv gestaltet werden, dass die Ghettoisierung aufgebrochen wird. Wir brauchen viel mehr Sozialarbeiter, die uns bei der täglichen Arbeit unterstützen. Wir brauchen mehr handwerkliche Angebote, mehr Tanztherapeuten und Medienangebote, damit die Mittelschicht hier nicht komplett wegzieht. Die Rütli-Schule ist ja inzwischen zu einer Vorzeigeschule geworden, weil sie unheimlich viele finanzielle Mittel erhalten hat.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass in der Politik nicht so viel dummes Zeug erzählt wird.
Es werden oft Verknüpfungen hergestellt, die es so einfach nicht gibt. Da würde es helfen, mit Migrationsforschern zu sprechen, die haben ihre Zahlen und Statistiken. Man muss die Situation differenziert betrachten und man kann das Problem nicht verallgemeinern. Hier werden bestimmte Probleme vermengt, die meiner Meinung nach nicht vermengt werden dürfen. Der Fehler beginnt bei der Vermengung von Migranten im Allgemeinen und Unterschichtsmigranten, die zum Teil in kriminellen Banden ihr Unwesen betreiben. Diese Verknüpfung ist falsch. Es gibt Erfolge in der Migration. Es ist inzwischen bewiesen, dass sich zum Beispiel die Geburtenrate bei der Migration in ein Industrieland ändert und der neuen Heimat anpasst.