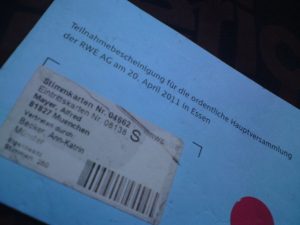Liebe iPhone-Mitläufer,
Liebe iPhone-Mitläufer,
es war Demo-Woche. Gegen Energieriesen, gegen die Rüstungsindustrie. Für ein Recht auf Zukunft vielleicht, womöglich für ein Leben ohne Konsumterror. Bei solchen Veranstaltungen sind dann viele Fahnen zu sehen, meist von deutschen Parteiorganisationen, aber auch ein Tangoverein zum Beispiel hätte sicherlich mitmachen können – hat er aber nicht, wie die meisten. Im Internet wiederum bekennen sich hin und wieder mal Leute zu diesem und jenem, aber das meist anonym. Auf der Straße hingegen: Nahezu Fehlanzeige. Sind letztlich doch alle Geiseln des Systems und wird der Widerspruch nur demonstriert, aber nicht gelebt? Hätten die Menschen mehr Zeit, wäre es dann anders? Müsste es Freibier geben? Mehr zum Anclicken?
Die Rebellenpose ist schon seit langem nur noch okay, wenn sie ausschließlich als sexy gemeint ist und am besten auch noch zu Macht führt. Deshalb sind seit langem bestehende, offenkundig falsche Verhältnisse so unangenehm und werden symbolisch bestraft, aber eben nicht abgewählt oder so etwas. Denn coole Rebellen scheitern ungern, also gibt es das Problem nicht – oder sie werden so ins beständige Scheitern gepresst, dass sie echt schlecht aussehen, auf Demos zum Beispiel, denn diese Art Menschen ist wenigstens noch dabei. Wer Gewinnertyp sein möchte und das vor allem bleiben will, stänkert nur, setzt aber real immer auf die sicheren Pferde – oder macht aus allem so etwas wie Funpunk und Demosport. Gewinnertypen können natürlich auch coole Konsumismus-Modernisierer sein, die von links nach rechts gehend zuerst Orte, Staaten oder Menschen(gruppen) destabilisieren, damit dann bestimmte Abhängigkeiten von bestimmten „Stabilisatoren“ entstehen, die im Grunde natürlich das klassische Opium fürs Volk sind. Aber das bringt dann Wachstum und deshalb muss es von diesen Waren halt immer neue geben. Wie sagte gestern eine Nachbarin von mir: „Du kennst mich doch! Anders interessiert mich nicht. Neu muss es sein!“
 Dabei gibt es klare Forderungen: „Bundeswehr raus aus den Schulen!“ zum Beispiel. Liebe Kinder, für Erwachsene sieht das in Essen so aus: Ihr geht von der Uni aus in Richtung Einkaufsstadt. Da seht Ihr dann rechts den Weg, der zu ThyssenKrupp führt und direkt daneben die Rotlichtstraße. Wenn Ihr dann dazwischen neben dem Parkhaus durch die Büsche springt, kommt Ihr zu einer Straße, an der das Rekrutierungsbüro der Bundeswehr liegt, genau auf der Rückseite der Agentur für Arbeit. Dann doch lieber von der Uni direkt in die Einkaufsstadt und zu all den Firmen, wo Ihr gesittet arbeiten könnt, oder? Wer gar nicht erst zur Universität gehen wird und diese Stadtarchitektur nicht zu sehen bekommt, wird natürlich schon in der Schule mit der Möglichkeit vertraut gemacht, ja auch an die Front gehen zu können. Das ermöglicht dann doch den Weg ins Rotlichtviertel, aber als Kunde, und ebenso auch den zu all den tollen Waren in den glitzernden Kaufhäusern. Nicht für den Konsum arbeiten geht nicht, entweder macht Ihr das hier oder halt mit der Waffe in der Hand in anderen Ländern. Damit die auch so werden. Das, liebe Kinder, will Euch diese Stadt erzählen.
Dabei gibt es klare Forderungen: „Bundeswehr raus aus den Schulen!“ zum Beispiel. Liebe Kinder, für Erwachsene sieht das in Essen so aus: Ihr geht von der Uni aus in Richtung Einkaufsstadt. Da seht Ihr dann rechts den Weg, der zu ThyssenKrupp führt und direkt daneben die Rotlichtstraße. Wenn Ihr dann dazwischen neben dem Parkhaus durch die Büsche springt, kommt Ihr zu einer Straße, an der das Rekrutierungsbüro der Bundeswehr liegt, genau auf der Rückseite der Agentur für Arbeit. Dann doch lieber von der Uni direkt in die Einkaufsstadt und zu all den Firmen, wo Ihr gesittet arbeiten könnt, oder? Wer gar nicht erst zur Universität gehen wird und diese Stadtarchitektur nicht zu sehen bekommt, wird natürlich schon in der Schule mit der Möglichkeit vertraut gemacht, ja auch an die Front gehen zu können. Das ermöglicht dann doch den Weg ins Rotlichtviertel, aber als Kunde, und ebenso auch den zu all den tollen Waren in den glitzernden Kaufhäusern. Nicht für den Konsum arbeiten geht nicht, entweder macht Ihr das hier oder halt mit der Waffe in der Hand in anderen Ländern. Damit die auch so werden. Das, liebe Kinder, will Euch diese Stadt erzählen.
„Kein Land darf Testgebiet für Waffen sein!“ Und natürlich auch kein Testgebiet für Drogen aller Art, inklusive technischer Neuerungen. Bitte die Reihenfolge beachten: Erst kam Facebook, dann die Drohnen. Später Konsumgüter. Anfixen, warten lassen, Überlegenheit demonstrieren, warten lassen. Substitute und Lifestyle rankarren. Warten lassen. Nächste Generation im Anmarsch? Härteren Stoff rankarren. Permanent nur warten lassen. Oder wie ein Bekannter sagte, dem ich eine Mischung aus Junkie- und Co-Abhängigen-Logik vorwarf: „Ey, wir leben nunmal in einer Drogengesellschaft!“ Klang exportfähig. Ich jedenfalls kann in viele Läden in Essen derzeit nicht gehen, weil ich mich nicht einem oder zwei gewissen Drogengebahren anpassen mag. Mangelnde Ignoranzkompetenz bestimmt.
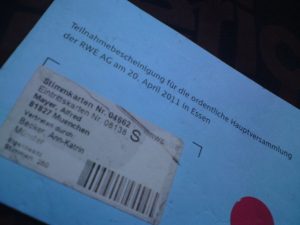 „Möglichst schneller Atomausstieg und Ächtung von Nuklearwaffen!“ Dass seit einiger Zeit manche Menschen ihre Zeitgenossen als Freiwild betrachten, mit denen alles gemacht werden darf, weil diese ja – zumindest ab einem gewissen Alter – aber auch alles immer ganz freiwillig tun, daran scheint sich die jüngste Generation schon fast gewöhnt zu haben. Aber der Spielplatz kennt anscheinend keine Grenzen. Denn auch die Zukunft wird von manchen einfach immer weiter eingeschränkt, Prozesse angestoßen, die dann später mal jemand anders klären soll oder auch nicht. Mehr Laissez-faire-Darwinismus geht kaum, außer bei der Gentechnologie und PID vielleicht noch. Im „Kleinen“ werden ebenso kaltschnäuzig Diktatoren installiert, die spätere Politgenerationen dann beseitigen müssen. Als würden die Väter sagen: „Jungens, ich hab Euch da mal ein bisschen was ins Nest gelegt. Ihr werdet sehen, Ihr müsst Euch auch die Finger schmutzig machen.“ In Atommüll gedacht: „Ach, schießen wir Erdlinge das irgendwann halt auf den Mars, ich seh da seit Jahren nicht, dass da jemand ist.“
„Möglichst schneller Atomausstieg und Ächtung von Nuklearwaffen!“ Dass seit einiger Zeit manche Menschen ihre Zeitgenossen als Freiwild betrachten, mit denen alles gemacht werden darf, weil diese ja – zumindest ab einem gewissen Alter – aber auch alles immer ganz freiwillig tun, daran scheint sich die jüngste Generation schon fast gewöhnt zu haben. Aber der Spielplatz kennt anscheinend keine Grenzen. Denn auch die Zukunft wird von manchen einfach immer weiter eingeschränkt, Prozesse angestoßen, die dann später mal jemand anders klären soll oder auch nicht. Mehr Laissez-faire-Darwinismus geht kaum, außer bei der Gentechnologie und PID vielleicht noch. Im „Kleinen“ werden ebenso kaltschnäuzig Diktatoren installiert, die spätere Politgenerationen dann beseitigen müssen. Als würden die Väter sagen: „Jungens, ich hab Euch da mal ein bisschen was ins Nest gelegt. Ihr werdet sehen, Ihr müsst Euch auch die Finger schmutzig machen.“ In Atommüll gedacht: „Ach, schießen wir Erdlinge das irgendwann halt auf den Mars, ich seh da seit Jahren nicht, dass da jemand ist.“
 Man könnte sich also ganz schön schämen als Erdling. Ach was, besser davon ausgehen, dass der Mensch schon immer so war und überall so ist. Und wer nicht so ist, ist halt krank oder so, ne? Auf gar keinen Fall darf jemand anders sein! Und wenn doch: Sofort infiltrieren, kolonialisieren, gar nicht einmal töten, besser: herabwürdigen. Niemand lache unserer Unkultur ins Gesicht! Alle müssen so sein wie wir, oder Diener, Zulieferer, Neger halt. Dirnen vielleicht noch. Aber es gibt keine andere Würde, erst recht keine höhere als die unsere! Wer das behauptet, widerspricht der Geschichte, der Evolution, der zu uns führenden Vergangenheit und der sich immer wieder selbst bestätigenden Gegenwart. Und die Zukunft belasten wir auch mit unserem Müll, auf dass diese unsere Lebensart federführend bleibt in Ewigkeit. So sieht’s aus, Neger! Jetzt vielleicht das Goldkettchen, den heißen Schlitten, das Crack und die angespitzte Schickse da vorne? Und alle so: Jau, da mag ich mich dann gleich viel besser leiden! And the colored girls go: “Frohes Fest!”
Man könnte sich also ganz schön schämen als Erdling. Ach was, besser davon ausgehen, dass der Mensch schon immer so war und überall so ist. Und wer nicht so ist, ist halt krank oder so, ne? Auf gar keinen Fall darf jemand anders sein! Und wenn doch: Sofort infiltrieren, kolonialisieren, gar nicht einmal töten, besser: herabwürdigen. Niemand lache unserer Unkultur ins Gesicht! Alle müssen so sein wie wir, oder Diener, Zulieferer, Neger halt. Dirnen vielleicht noch. Aber es gibt keine andere Würde, erst recht keine höhere als die unsere! Wer das behauptet, widerspricht der Geschichte, der Evolution, der zu uns führenden Vergangenheit und der sich immer wieder selbst bestätigenden Gegenwart. Und die Zukunft belasten wir auch mit unserem Müll, auf dass diese unsere Lebensart federführend bleibt in Ewigkeit. So sieht’s aus, Neger! Jetzt vielleicht das Goldkettchen, den heißen Schlitten, das Crack und die angespitzte Schickse da vorne? Und alle so: Jau, da mag ich mich dann gleich viel besser leiden! And the colored girls go: “Frohes Fest!”
Logo: Friedensbündnis-ka.de
Fotos (feat. ua. die 13th Floor Elevators): Jens Kobler