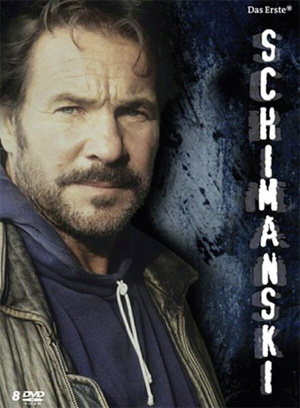Ihr wollt die Welt retten, Leute? Wegen Fukushima? Vergesst es! Diese Welt ist nicht zu retten. Die Sache ist vermasselt. Ein für allemal.
Ihr wollt die Welt retten, Leute? Wegen Fukushima? Vergesst es! Diese Welt ist nicht zu retten. Die Sache ist vermasselt. Ein für allemal.Ob die japanischen Helden die Katastrophe noch mal gedreht kriegen oder nicht. Kaum dass wir diese absolut unermessliche Tragödie wieder vergessen haben und ganz Japan gleich mit, weil das Land als Lebensraum wohlmöglich gar nicht mehr existiert, geht ein anderes Kraftwerk hoch. Die mathematische Wahrscheinlichkeit ist eine durchaus bittere Tatsache, weil, wenn auch nicht genau auf den Tag bestimmbar, absolut rational. Gänzlich resistent gegen jede Art der Emotion, von geradezu systemischer Hoffnungslosigkeit. Genauer gesagt: es könnten sogar mal 2 parallel an verschiedenen Orten aus den Fugen geraten.
Das ist aber gar nicht unser Problem, Leute. Die Crux ist, dass uns das nichts ausmacht, solange es noch nicht passiert ist. Wir können zwar alle möglichen Katastrophen berechnen. Aber das Ergebnis ist uns letztlich egal, wenn es uns im Moment gut geht. Machen tun wir erst was, wenn es zu spät ist. Und bei der Atomkraft ist es schon lange zu spät. Egal wie viele Leute jetzt noch auf die Straße gehen. Egal wie viele Politikerinnen und Politiker jetzt ihre Meinung wechseln. Egal wie viele Atommanager noch ein paar Krokodiltränen abdrücken.
Wir tanzen schon lange auf dem Vulkan. Egal ob Hartz IV- oder Boni-Empfänger. Es gibt einen gewaltigen Grad an struktureller Dämlichkeit der uns alle verbindet: Wir regen uns zwar liebend gerne auf, aber wir ändern uns nicht. Nicht im Geringsten. Wir sind für den momentanen Spaß gemacht Leute, nicht für das was danach kommt. Selbst wenn er nur darin besteht andere zu quälen, zumindest aber sich über sie lustig zu machen. Mitleid ist einfach nicht unsere Stärke, wenn es nicht Menschen trifft, die uns ganz persönlich was bedeuten. Zumindest nicht für länger als 10 Minuten am Stück. Mitgruseln schon eher. Zumindest solange wir selbst nicht in der Scheiße stecken.
Wer würde denn von uns freiwillig in ein komplett verstrahltes Atomkraftwerk gehen um es zu reparieren? Wir schaffen es ja nicht mal Jemanden, der einen anderen vor unseren Augen totschlägt, obwohl wir in der Überzahl sind, zurück zu halten. Wir könnten ja dabei auch eins auf das Maul kriegen. Und wer weiß, ob alle mitmachen? Und vielleicht ist der Kerl ja so stark, dass er uns alle mitsamt fertig macht? Dann doch lieber stehen bleiben und mit gruseln oder sich gleich verdrücken.
Ob wir uns das eingestehen wollen oder nicht, unsere Parole lautet, ob schlau oder doof, dick oder dünn, alt oder jung, Mann oder Frau: nach uns die Sintflut. Auch wenn wir andauernd von der Zukunft unserer oder anderer Leute Kinder faseln. Es ist uns ziemlich egal was aus ihnen wird, wenn wir nicht mehr da sind. Sonst würden wir ihnen, wenn überhaupt, was anderes hinterlassen als Geld, Klunker, Autos, Wochenendhäuser oder Lebensversicherungen. Wie wäre es stattdessen mit einer gesunden Umwelt? Mit weniger öffentlichen Schulden? Mit Kunst und Kultur? Mit Allgemeinbildung?Mit Mehrsprachigkeit?
Oder einfach nur mit weniger Kindern? Weltweit? Millionen von ihnen krepieren doch schon heute, ehe sie überhaupt das 6. Lebensjahr erreichen. Von den Millionen die sich als Arbeits- oder Sexsklaven verdingen müssen, viele übrigens mit der Einwilligung zumindest aber mit dem Wissen ihrer Eltern, ganz zu schweigen. Wir sind sowieso schon viel zu viele auf dieser Welt. Wir würden ihr und uns selbst einen riesigen Gefallen tun, wenn wir jedes Jahr weniger würden. Egal was uns die Religionsphantasten, Traditionsgläubigen, Familienideologen und Wachstumsfetischisten dieser Welt erzählen.
Sie reden allesamt Quatsch. Denn wenn wir uns selbst nicht rechtzeitig dezimieren wird es die Natur tun bzw. unser eigener Kampf um den Rest, der davon für uns noch zu gebrauchen ist. Der fälschlich von uns so genannten Mutter Natur ist das übrigens völlig egal. Sie ist ähnlich strukturiert wie die Mathematik. Unaufhaltsam logisch. Gott-und respektlos. Nicht darauf angewiesen ob sie jemand versteht, ja ob sich überhaupt jemand für sie interessiert. Mit einem Satz: das physikalische- materielle Universum kann gut ohne uns auskommen.
Deswegen könnte nicht geboren zu sein in nicht allzu weiter Zukunft der größte Wunsch vieler Menschen werden. Kaum vorzustellen wenn man gerade vor eine prall gefüllten Lebensmitteltheke steht oder ein wunderschönes Konzert hört oder mit Freunden eine Bergwanderung in Tirol macht oder auf dem lang erträumten Segelboot in die untergehende Sonne schippert. Oder wenn man einfach nur jeden Tag Geld bekommt ohne auch nur in Gedanken einer Arbeit nachzugehen während andere leiden, ja krepieren müssen, weil sie weder an einen Job noch an Moneten kommen können.
Ich weiß, dass solche Gedanken nichts anderes als ärgerlich sind. Sie bringen auch nicht viel, denn wer sollte z.B. entscheiden wo wer weniger Kinder bekommt oder sogar gar keine. Eine Weltregierung? Oder in Ermangelung einer solchen der Rat für Menschenrechte bei der UNO? Beides für mich eine eher gruselige Vorstellung ? Dann doch besser die sogenannte natürliche Auslese, oder? Die ist natürlich gar nicht natürlich, aber was soll es. Hauptsache man muss nicht selbst entscheiden. Ist viel zu schwierig. Gerade beim Kinderkriegen. Und grundsätzlich fragwürdig, wo doch rein wissenschaftlich gar nicht mehr klar ist, ob wir überhaupt einen eigenen Willen haben.
Jetzt mal angenommen die Forscher haben damit recht. Wobei man sich natürlich fragt, wie die ohne eigenen Willen überhaupt dazu gekommen sind, genau wissen zu wollen, ob sie einen haben. Aber egal. Der Gedanke, dass wir alle keinen eigenen Willen haben, ist doch faszinierend, oder? Man ist dann, rein logisch betrachtet, nicht mehr schuldig. Im Nachhinein und in Voraus, also immer und ewig. Das heißt z.B.: nie mehr Angst vor dem Jüngsten Gericht. Und keine unnötigen Erklärungen während man noch lebt. Alles geht seinen Gang. Nur dabei sein ist wichtig. Mitmachen statt irgendetwas irgendwo gegen zu unternehmen. Das ist es doch! Oder? Und war es das nicht schon immer? Zumindest für die meisten von uns?
Obendrein wüssten wir endlich und absolut sicher wieso uns die Zukunft sowas von egal ist: Weil wir nichts gegen sie tun k ö n n e n, Leute! Wir sind nämlich das Problem und nicht, wie die Guten von uns immer dachten, (auch) die Lösung. Ergo: wenn überhaupt rettet uns der Zufall. Und mal ehrlich Leute, haben wir nicht immer schon darauf gesetzt. Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt heißt das seit einiger Zeit. Kennt ihr doch. Ideen die vorher noch keiner hatte. Wozu haben wir denn unser phänomenales Gehirn? Zumindest einige von uns. Und wozu das Copyright? Und den Nobelpreis? Wir sind doch keine Fatalisten!
Eine geniale Erfindung muss also wieder mal her, wie z.B. die Kernschmelze rückwärts durch dauerhaftes kollektives Anstarren eines Kraftwerks. Auch per Fernsehen und Internet. Oder das Perpetuum Mobile in Form eines immer und ewig laufenden Windrades, das nie repariert werden muss und zugleich unsichtbar ist. Samt Zu- und Ableitungen. Oder eine Rakete die 10 Milliarden Menschen aufnehmen kann, ohne beim Start in den Weltraum Energie zu verbrauchen. Ihr wisst doch: Nichts ist unmöglich.
Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Was schreibe ich hier eigentlich für einen Unsinn? Es lag doch garnicht an der Atomkraft sondern an der Kühlung. Hätte die Kühlung funktioniert, dann wäre doch garnichts passiert. Wir müssen also nur die Kühlung verbessern. Sie muss völlig unabhängig werden von allen möglichen äußeren Einflüssen und immer Strom haben. Natürlich aus Sonnenenergie. Und dieser lästige Atommüll wird einfach per Rakete ins Weltall geschossen. Die Raketen haben wir, und da sich das Universum nachgewiesenermaßen ständig ausdehnt, ist das doch wohl die sicherste Entsorgung der Welt, oder?