Bloodsucking Zombies From Outer Space, Dienstag, 29. März, 20.00 Uhr, Zwischenfall, Bochum
Der Ruhrpilot

Wahl: Grün-Rot passt vorerst nicht zu Baden-Württemberg…Welt
Wahl II: Absturz im Stammland…FAZ
Wahl III: Mappschied in Stuttgart…taz
Wahl IV: Mappus und Homburger missbrauchen Fukushima schon wieder – als Alibi…Frontmotor
NRW: CDU setzt weiterhin auf Neuwahlen…RP Online
NRW II: Wohnungsgesellschaft LEG plant Blockverkäufe…RP Online
Essen: Handgreifliche Linken-Sitzung hat ein Nachspiel…Der Westen
Essen II: Mobil machen auf der A52-Zielgeraden…Der Westen
Dortmund: Mit Hauruck wird der Straßenstrich nicht leer…Der Westen
Dortmund II: Live macht das Kreuzviertel besonders viel Spaß…Ruhr Nachrichten
Dortmund III: Kampf gegen Rechts macht Schule…Der Westen
Bochum: Der VfL stellt die besten Helden von 1997…Pottblog
Oberhausen: 60 Verletzte nach Panik bei DSDS-Autogrammstunde…Ruhr Nachrichten
Umland: Schwarz-Grün hat in Frankfurt 59,3 Prozent…Journal Frankfurt
Umland II: Meschede und eine “undemokratische” Petition…Zoom
BaWü und RP: Grüne räumen ab
 Die Grünen sind die großen Gewinner des Wahlabends. In Baden-Würtemberg könnten sie den Ministerpräsidenten stellen. In Rheinland-Pfalz sind sie fast sicher in der Regierung.
Die Grünen sind die großen Gewinner des Wahlabends. In Baden-Würtemberg könnten sie den Ministerpräsidenten stellen. In Rheinland-Pfalz sind sie fast sicher in der Regierung.
Baden-Würtemberg
ZDF: CDU 38,5%, SPD 23,5%, GRÜ 24,5%, FDP 5,2%, Linkspartei 3,0%
Ein Desaster für die Union. Ein Stammland geht nach 58 Jahren verloren. Die Grünen könnten den Ministerpräsidenten stellen und die SPD konnte mit einem blassen Kandidaten nicht von der Wechselstimmung profitieren. Es war eine Abstimmung gegen die Kernkraft und gegen S21. Das wird Folgen haben: Die Kernenergie wird schneller verschwinden als es CDU und FDP im Bund geplant haben. Die Laufzeitverlängerung dürfte Geschichte sein. Klar ist aber auch: So schnell wird sich keine Regierung mehr für ein Großprojekt wie S21 stellen. Großprojekte werden in Deutschland damit in Zukunft fast unmöglich. Das Land ist durch diese Wahl zugleich grüner und konservativer geworden.
Rheinland Pfalz
Prognose ZDF • CDU 35,5%, SPD 36,0%, GRÜ 15,0%, FDP 4,0%, Linkspartei 3,5%
Ministerpräsident Beck zahlt die Zeche für den Skandal um den Nürburgring. Nur lustiger Bär sein reicht nicht mehr. Die Grünen profitieren auch in Rheinland-Pfalz von Fukushima und werden wohl künftig in der Regierung sitzen.
Bund
Für Merkel wird es eng, für Westerwelle enger. Noch nie gab es einen so unbeliebten Aussenminister. Er hat Deutschland im Westen isoliert. Er führte seine Partei in den vergangenen Jahren von Niederlage zu Niederlage – Ausnahme: Hamburg. Keinen Erfolg zu haben und unbeliebt zu sein sind nicht die besten Qualifikationen um Parteichef, Aussenminister und Vizekanzler zu sein. Der Anfang von seinem Ende sollte heute begonnen haben.
Und die Linkspartei? Spielte in beiden Ländern keine Rolle. Nationalpazifismus und Sozialpopulismus kommen nicht mehr an. Für mich eine gute Nachricht.
NRW
Die SPD wird jetzt erst Recht keine Lust auf Neuwahlen haben. Sie wird trotz Kraft kaum profitieren können. Auch Union, FDP und Linkspartei werden alles tun, Neuwahlen zu vermeiden. Schade. In NRW könnte es wie in Rheinland-Pfalz wieder ein drei Parteien Parlament geben. Die SPD sollte in den sauren Neuwahl-Apfel beissen und die Chance ergreifen, die Linkspartei im Westen zu enstorgen.
letzte Woche / diese Woche (kw13)
 „You need hands to show the world you’re happy“ – Malcolm McLaren
„You need hands to show the world you’re happy“ – Malcolm McLaren
Erinnern Sie sich? England und Frankreich sind im Krieg mit Libyen, letzterer Staat durch die Anerkennung der Rebellen-Regierung für sein eigenes Verständnis aber nicht wirklich, sondern nur mit der Gaddafi-Fraktion. Das sieht der Rest der Welt wiederum anders. In diesem Zusammenhang ein Gruß an die Türkei: Ehrenwerter Versuch! Die „Welt“, also die UN, hatte die Einrichtung einer Flugverbotszone erwirkt, die nun die NATO durchsetzen soll. England ist aber auch in der NATO. Schießen die dann auf ihre eigenen Flugzeuge, wenn diese jenseits des UN-Mandats operieren? Kaum. Müsste also nicht jemand anders als die NATO das Flugverbot überwachen? Oder gilt für die Franzosen und Engländer als fröhliche Anarchisten mit kolonialer „Zuständigkeit“ eine Sonderregelung?
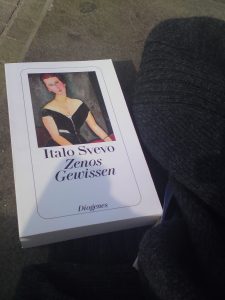 Leider habe ich es letzte Woche verpasst, diese Frage mit meinen Bekannten englischen oder französischen Migrationshintergrundes zu diskutieren. Stattdessen war ich endlich einmal in der Essener Proust Buchhandlung und habe mir „Zenos Gewissen“ von Italo Svevo gekauft. Lag da rum. Kritiken und Texte auf Buchrücken versuchen ja immer zu erzählen, wie man etwas zu lesen hat – auch deshalb lese ich solche Empfehlungen am ehesten entweder nach der Lektüre oder nur dann, wenn ich das Buch eh nicht lesen, den Film nicht schauen, das Album nicht hören will. Diesmal aber fühlte ich mich sicher in meiner Herangehensweise an das Buch, las den Buchrücken und musste lächeln: „Italo Svevo“ heißt tatsächlich „der italienische Schwabe“. Weitere gute Sätze: „Eine grandiose Parodie auf die Psychoanalyse, noch bevor sie überhaupt populär wurde.“ „Der Spiegel: Eine grandiose Beichte“. Haha.
Leider habe ich es letzte Woche verpasst, diese Frage mit meinen Bekannten englischen oder französischen Migrationshintergrundes zu diskutieren. Stattdessen war ich endlich einmal in der Essener Proust Buchhandlung und habe mir „Zenos Gewissen“ von Italo Svevo gekauft. Lag da rum. Kritiken und Texte auf Buchrücken versuchen ja immer zu erzählen, wie man etwas zu lesen hat – auch deshalb lese ich solche Empfehlungen am ehesten entweder nach der Lektüre oder nur dann, wenn ich das Buch eh nicht lesen, den Film nicht schauen, das Album nicht hören will. Diesmal aber fühlte ich mich sicher in meiner Herangehensweise an das Buch, las den Buchrücken und musste lächeln: „Italo Svevo“ heißt tatsächlich „der italienische Schwabe“. Weitere gute Sätze: „Eine grandiose Parodie auf die Psychoanalyse, noch bevor sie überhaupt populär wurde.“ „Der Spiegel: Eine grandiose Beichte“. Haha.
Im Grunde gilt aber natürlich: Weder Spiegel noch Bild, und die anderen auch erst, nachdem man sozusagen das Buch der Geschehnisse selbst gelesen hat. Eine Kommentatorin der Süddeutschen meinte gar, die Staaten der Welt hätten zuerst „die Herzen über den Zaun geworfen“, um dann quasi bewaffnet hinterherzuspringen. Deutsche Kriegslyrik, da ist sie wieder, zum Glück bislang nur im Dienste zweier anderer europäischer Staaten. Oh, ich vergaß: Selbstredend auch im Dienste potentieller grüner Außenminister und Rechts-Sozen wie Siggi G. von und zu Seeheim. (Als Nahles rüberkam wie von Gaddafi geduzt, das war auch schön.) Und Joseph Fischer raunzt Identifikationsbegriffe wie bei seinem großen Krieg. Sie erinnern sich? Diese spezielle Fortsetzung der Ostpolitik von Willy Brandt, interpretiert á la Rot-Grün im Einheitsrausch.
Super-GAU in der Endlosschleife

Letztes Wochenende – immerhin lag das Erdbeben vor Japan da auch schon gut eine Woche hinter uns – konnten wir uns endlich anderen Dingen zuwenden: Bestimmte Dinge entwickelten sich gut, und die Libyen-Bombardements sorgten für ein wenig Abwechslung. Und für ein gutes Gewissen, wenn man nicht gerade ein Deutscher war. Was Japan betraf: Endlich Fortschritte, Hoffnung, sogar Strom, mitten im Atomkraftwerk. Jetzt meldet sich das Atomkraftwerk zurück. „Millionenfach erhöhte Strahlung gemessen“, rein landtagswahlmäßig nicht schlecht, doch wenn die ganze Sache jetzt in so eine Endlosschleife reinläuft, ist damit natürlich auch keinem Menschen gedient.
Die Gefahr sei „noch lange nicht gebannt“, sagt Yukiya Amano, der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA); die Sache kann sich also noch hinziehen. Andererseits: Amano wäre nicht Amano, wenn er nicht zugleich auch „positive Signale“ sähe. Jawohl. Wie am letzten Wochenende: die Wiederherstellung von Stromleitungen in dem ein oder anderen Reaktorblock. Na sicher: „Es muss aber noch mehr getan werden, um die Situation zu einem Ende zu bringen.“ IAEA-Chef müsste man sein.
Ist es nun schon ein Super-GAU oder nicht? Ab wann kann, darf, soll man überhaupt von einem Super-GAU sprechen? Das ist freilich Auslegungssache, so ein Auslegungsstörfall. Man kann von einem Super-GAU in Fukushima sprechen, deshalb darf man es auch. Ob man es dagegen auch tun soll, ist schon allein deshalb ein wenig in Zweifel zu ziehen, weil der Begriff den Eindruck erwecken könnte, als sei´s das jetzt im Großen und Ganzen gewesen. Als könne es nicht mehr schlimmer werden. Da hat aber Herr Amano Recht: die ganze Sache wird sich noch eine Weile hinziehen. Entsetzen in der Endlosschleife.
The Blue Van
The Blue Van, Montag, 28. März, 21.00 Uhr, Stadtgarten / Studio 672, Köln
Der Ruhrpilot
 Umland: Demonstrieren an der Deutzer Werft…Kölner Stadtanzeiger
Umland: Demonstrieren an der Deutzer Werft…Kölner Stadtanzeiger
Umland II: #AntiAKW #Berlin…Spreeblick
Umland III: Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz…Ruhr Nachrichten
NRW: „Wir brauchen weiterhin Kohlekraftwerke“…Welt
NRW II: Ansturm auf Grüne Energie…Welt
Essen: Die Töchter der göttlichen Liebe sagen Tschüss…Der Westen
Essen II: Gagfah im Häuserkampf in Dresden…FAZ
Essen III: Wie geht es mit dem JZE weiter?…Coolibri
Dortmund: Zimmer mit Aussicht im U-Turm…Der Westen
Dortmund II: 10/04 DERHANK liest Y, und N macht Musik…Unruhr
Duisburg: SPD, Linke und Grüne wollen einen Etat 2011 ohne Kahlschlag…Der Westen
Dortmund: Die Nordstadt und die Null-Toleranz-Strategie

Die Dortmunder SPD will die Probleme der Nordstadt durch eine Null-Toleranz-Strategie lösen. Selbst kleine Ordnungswidrigkeiten, wie das Schlafen im Auto, sollen laut Der Westen erbarmungslos verfolgt werden:
Wer im Auto übernachtet, muss mit einer kostenpflichtigen Verwarnung rechnen. Wer ein Gewerbe anmeldet und ihm nachgeht, muss sich auf eine Prüfung gefasst machen. Wer duldet und daran verdient, dass seine Wohnungen hoffnungslos überbelegt sind, muss sich gefallen lassen, dass Sicherheit, Statik und Brandschutz begutachtet werden und dass die Stadt das gesamte Repertoire der Bauvorschriften aus dem Köcher zieht. Wildes Parken, ein vermüllter Fredenbaumpark – all das will die SPD jetzt konsequent bekämpft wissen.
Das klingt erst einmal gut: Der Druck auf die Problemmilieus und verantwortungslose Vermieter wird erhöht. Die werden dann, so die Idee, aus Dortmund verschwinden. Plausibel. Oder?
Geoff Berner
Geoff Berner, Sonntag, 27. März, 19.00 Uhr, Christuskirche, Bochum
Der Ruhrpilot
 Protest: Tausende bei Auftaktkundgebung gegen Atomkraft in Köln…Ruhr Nachrichten
Protest: Tausende bei Auftaktkundgebung gegen Atomkraft in Köln…Ruhr Nachrichten
NRW: Kraft will Schuldenbremse…RP Online
NRW II:: Erdgas-Probebohrungen unterbrochen…Der Westen
NRW III: WestLB mit dreistelligem Millionenverlust…Neue Presse
Ruhrgebiet: Millionenstreit im Weltkulturerbe Zollverein…WAZ Rechercheblog
Ruhrgebiet II: Autos brennen im Revier…RP Online
Ruhrgebiet III: Immobilien-Investoren skeptisch…Spiegel
Bochum: Debatte über Frauen, Fußball und Geld…Der Westen
Bochum II: IHK verabschiedet Tillmann Neinhaus…Ruhr Nachrichten
Bochum III: Die kleine Rache der Staatsschützer…Bo Alternativ
Dortmund: SPD für Null-Toleranz-Linie in der Nordstadt…Der Westen
Duisburg: Zukunft des Kulturzentrums Hundertmeister ungewiss…Der Westen
Essen: Atom-Krise belastet den Etat der Stadt Essen…Der Westen
Essen II: Sekten-Info verzeichnet sprunghaften Zuwachs an Ratsuchenden…Der Westen
Umland: Lit.Cologne zeichnet Debütautor Tino Hanekamp aus…Ruhr Nachrichten
Medien: Was werden uns Leserreporter und Bürgerjournalisten bescheren?…Zoom
Apple: iPad 2 – gekauft beim mStore in Bochum…Pottblog
Bücher: Digital ist besser…Indiskretion Ehrensache


