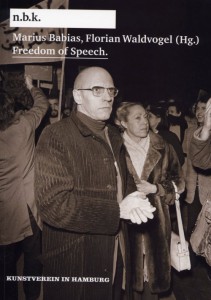Dem Journalisten Stefan Aigner ist untersagt worden, Zahlungen der katholischen Kirche an die Eltern eines durch einen Priester missbrauchten Jungen als „Schweigegeld“ zu bezeichnen.Das Netzwerk istlokal.de protestiert auf Schärfste gegen diese mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbare Entscheidung.
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Missbrauchsfälle bekannt. Duzende von Priestern hatten teils über Jahre hinweg hunderte von Ministranten und andere schutzbefohlene Kinder, überwiegend Jungen, sexuell missbraucht.
Anstatt diese Missbräuche an Leib und Seelen der Kinder konsequent aufzuklären, hat die katholische Kirche viele Fälle vertuscht, Priester versetzt, „Entschädigungszahlungen“ geleistet.
Nur auf großen Druck der Öffentlichkeit hat die katholische Kirche reagiert und immer nur das allernotwendigste getan, um „Aufklärung“ zu leisten.
Die Öffentlichkeit wurde und wird überwiegend durch mutige Journalisten wie Stefan Aigner über diese schon fast alltäglich zu nennende Missbrauchspraxis informiert.
Es ist nicht hinnehmbar, dass Journalisten, die über diese Missbrauchsfälle berichten, sich juristisch bedroht fühlen müssen.Nicht die Journalisten begehen einen Missbrauch, indem sie über Missbräuche berichten, sondern die katholische Kirche missbraucht das Justizsystem, indem sie als „Großkonzern“ gegen Journalisten vorgeht.
Der Regensburger Journalist Stefan Aigner hatte im Vorfeld versucht, sich mit der Diözese Regensburg auf eine andere Formulierung zu einigen. Daran hatte die Diözese kein Interesse. Man muss davon ausgehen, dass dem Journalisten – und mit diesem Fall auch anderen – eine „Lektion“ erteilt werden soll.
Dabei bedient sich die Kirche des so genannten „fliegenden Gerichtsstands“ – man sucht sich das Gericht aus, von dem man sich ein „erwünschtes Urteil“ verspricht.
Das Hamburger Landgericht ist bundesweit für pressefeindliche Urteile bekannt. Die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz gilt hier nicht besonders viel und wird bis an den Rand der Unerträglichkeit begrenzt.Die Prozesskosten für die erste Instanz schätzt Stefan Aigner auf rund 8.000 Euro. Ohne Unterstützung würden diese Kosten ihn in eine wirtschaftlich-existenzbedrohliche Lage bringen. Nach einem Spendenaufruf kamen rund 10.000 Euro zusammen – sonst hätte Stefan Aigner nicht vor Gericht gehen können, sondern sich sofort einer Unterlassungserklärung beugen müssen.
Aus Sicht des Netzwerks istlokal.de missbraucht die Kirche nun „Lücken“ im Rechtssystem, um sich missbräuchlich an der Presse- und Meinungsfreiheit zu vergehen. Anstatt die schändlichen Taten von Priestern lückenlos aufzuklären und öffentlich zu machen, soll Journalisten das berichten verboten werden. Man muss befürchten, dass Journalisten zukünftig nur noch mit der „Schere im Kopf“ über den Missbrauch von katholischen Priestern an Kindern berichten oder aus Angst vor Klagen ganz darauf verzichten.
Wir halten es für unerträglich und nicht hinnehmbar, dass eine Institution wie die katholische Kirche weder bereit ist, sich außergerichtlich zu einigen, sondern versucht, einen Journalisten wirtschaftlich zugrunde zu klagen.Das Netzwerk istlokal.de fordert hiermit die Diözese Regensburg auf, alle Kosten des Prozesses zu übernehmen und die Aufhebung des Urteils zu beantragen.
Weiter fordern wir die Diözese Regensburg auf, mit dem Journalisten Stefan Aigner in einen Dialog zu treten und eine für beide Seiten „akzeptable“ Formulierung für den betreffenden Bericht zu finden.Weiter fordern wir von der Diözese Regensburg eine Erklärung, dass sie die Presse- und Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz achtet und Journalisten bei der der Aufklärung und Veröffentlichung von Missbrauchsfällen ohne Einschränkung unterstützt.