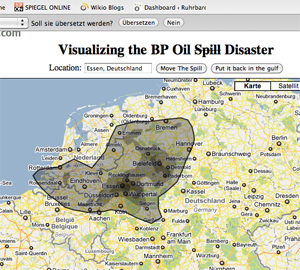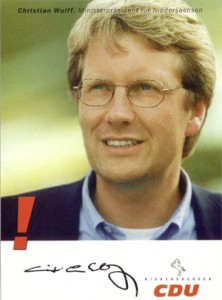Während das Ruhrgebiet noch auf die Kreativwirtschaft setzt ist man in Berlin schon weiter: Industrie soll her. Doch auch die Hauptstadt hat ausser bunten Broschüren nicht viel zu bieten. Von unserem Gastautor Frank Muschalle. Frank betreibt das Blog Frontmotor, stammt aus dem Ruhrgebiet und lebt und arbeitet in Berlin.
Während das Ruhrgebiet noch auf die Kreativwirtschaft setzt ist man in Berlin schon weiter: Industrie soll her. Doch auch die Hauptstadt hat ausser bunten Broschüren nicht viel zu bieten. Von unserem Gastautor Frank Muschalle. Frank betreibt das Blog Frontmotor, stammt aus dem Ruhrgebiet und lebt und arbeitet in Berlin.
Wer ist kreativ?
Ich kenne etliche Anhänger von Richard Floridas These, dass die Zukunft den Kreativen gehört. Aber ich kenne keinen Manager oder Politiker, der sie in Deutschland mal in größerem Stil richtig umgesetzt hätte. Geht es um „Kreative“, fühle ich mich auch als Ingenieur angesprochen. Ich habe an der Entwicklung von StartStop-Automatiken und Hybridantrieben mitgearbeitet. Ich habe Wettbewerbe für Konzerngeschäftsideen und Hauptstadtphotographien gewonnen. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage: Kreativität wird in der Industrie nicht wirklich wertgeschätzt. Das „Management“ von Kreativen, bzw. das Verwerten ihrer Leistungen, schon eher. Ich habe schon länger den großen Plan in der Tasche, um irgendwann den Absprung zu machen. Aber irgendetwas hält mich davon ab.
Richard Floridas Leistung liegt meiner Meinung nach darin, zu erkennen, wie wichtig der Modus ist, in dem Kreative arbeiten. Welches die Bedingungen sind, die sie für attraktiv halten. Aber auch unter welchen Bedingungen, aus Kreativen ein Big Business werden kann. Kreativ sind in diesem Zusammenhang alle, die Werke schaffen, die durch ein gewerbliches Schutzrecht schützbar sind, also Texte, Grafiken, Filme, Fotos, Musik, technische Lösungen und Software.
Die kreativen Geschäftsmodi
Es gibt Kreative, die in Vorleistung gehen. In ihr Werk investieren, ihre Schutzrechte absichern und dann Kunden dafür suchen, die bereit sind, für Lizenzen zu bezahlen. Das sind die Unternehmer in eigener Sache. Sie schaffen Produkte, die sich durch einfaches Kopieren beliebig vervielfachen und als Stücklizenzen verkaufen lassen. Diese Kreativen schaffen Arbeitsplätze in der Entwicklung, Redaktion, im Studio und in der Produktion und sie generieren Steuereinnahmen. Ihnen kommen Multiplikatoreffekte zu.
Und es gibt Kreative, die mögen die gleiche Ausbildung und Bildung genossen haben, und die gleichen Dinge tun, sogar die gleichen Werke herstellen. Der wichtige Unterschied: Sie tun dies im Auftrag. Als Dienstleistung. Ihr Vorteil: Sie müssen keine Investitionen riskieren, kein Eigenkapital beschaffen. Und sie haften nicht. Ihr Nachteil: Sie werden nach Aufwand bezahlt und haben in der Regel eine Klausel in ihrem Dienstleistungsvertrag, nach der sie die Verwertungsrechte an ihren Auftraggeber abgeben. Diese Kreativen sind die Prototypen der Ich-AGs. Sie erfinden das Rad immer wieder neu, im Auftrag für andere. Von Multiplikatoreffekten profitieren sie nur wenig.
Richard Florida und seine Anhänger wie Wolf Lotter meinen erstere, wenn sie von der Creative Class schwärmen. Auch der frühere Blogger, Podcaster und heutige Chefinnovator bei HP, Phil McKinney meinte die Produktentwickler, als er sagte: Kreativität kann jeder lernen. Man muss es einüben, es fällt nicht vom Himmel. Die Politik und viele Wirtschaftsförderungen jedoch haben das Thema lange missverstanden und dachten, hinter mancher Ich-AG lauere ein Steve Jobs.
Richtig ist auf jeden Fall: Nur durch kreative Leistungen schaffen wir neues Wachstum (wenn wir das wollen). Nicht durch Nachahmung und Preisdumping. Einer der wenigen richtigen Sätze von Angela Merkel lautet: Wir dürfen um soviel teurer sein, wie wir besser sind. Aber um besser zu sein, muss man etwas riskieren. Und braucht einen Instinkt für Chancen. Was wir im vergangenen Jahrzehnt aber erlebten war: Ihr müsst um so viel billiger werden, wie wir Euch schlechter managen. Das war die Ansage in vielen Konzernen.
Der freiberufliche Auftragsprogrammierer konkurriert gegen die unschlagbar billigen Konkurrenten aus Indien und China. Der Lizenzgeber aber, der ein Produkt für einen neuen Markt erdacht, geschaffen und mit Schutzrechten abgesichert hat, muss wenig Konkurrenz fürchten. Hat das jetzt jeder verstanden, der Politik gestaltet und Wirtschaftsförderung betreibt?
Berlin und das Ruhrgebiet im Dienstleistungszeitalter
Landes- und Regionalpolitiker haben einige Lernprozesse hinter sich. Und gerade das Ruhrgebiet und Berlin haben sehr ähnliche Lernprozesse hinter sich. Beiden brach die industrielle Basis weg. Sie beobachteten wie Massenarbeitsplätze aus der Produktion nach Fernost exportiert wurden. Ihre Reaktion darauf: Dann müssen wir uns auf das stürzen, was nicht exportiert werden kann: Dienstleistungen. Die müssen immer am Kunden, also im Lande, erbracht werden. Deshalb waren Dienstleistungen das neue Allheilmittel. Doch sie taugten als wirtschaftspolitische Strategie nur dafür, Leute über Wasser zu halten. Beispielsweise in Callcentern. Callcenter haben keine Schornsteine und beschäftigen trotzdem hunderte von Leuten zu beliebig flexiblen Arbeitszeiten. Und nutzen Telekommunikation, waren also nach dem Verständnis von Regionalpolitikern „innovativ“.
Ein früherer Kollege sagte vor fünfzehn Jahren so passend: „Deutschlands Zukunft liegt nicht darin, dass wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden.“ Da wussten wir noch nicht, dass es auch eine Dienstleistungswelle für Akademiker geben würde: Dienstleistung, oder gar Beratung, als Euphemismus für „akademische Leiharbeit“. Wieder ein Missverständnis zwischen Politik und Wirtschaft. Der dienstleistende Akademiker ist ein vagabundierender Experte mit Out-of-Area-Einsätzen fern seiner Heimat und Familie. Die Beratungsfirma steuert wenig zu seiner Expertise bei. Die erwirbt er sich im Job. Seine Expertise ist das Einzige, was ihm keiner nehmen kann. Wohlgemerkt, eine Expertise für eine Bedingung, die die andere definiert haben: Softwareprodukte, Prozesse, Rechte, Standards.
Kreativ ist der Experte, der eine unbediente Marktlücke erkennt, und eine Produktidee entwickelt. Einen Prototypen bastelt und an Probanden testet. Sich dann Startgeld bei Freunden und Familien leiht und damit zur Bank geht und weiteres Geld leiht. Das ist mein Verständnis. Doch die meisten meiner Bekannten, die das Zeug hierfür hätten, bleiben lieber angestellte Kopfwerker. Das Ruhrgebiet hat das Malocherethos auf den Kopf übertragen. Berlin wiederum hat seine antikapitalistische Grundhaltung verinnerlicht. Man gründet nicht, um reich zu werden.
Der Kreative – arm, aber sexy
Der Berliner Senat schwamm eine Weile auf der kreativen Welle mit. Weil Berlin so viele Kreative hat: Zig Modedesigner in der Kastanienallee in Berlin Mitte. Tausende „selbständiger“ Softwareentwickler. Aber daraus wurden nur ganz wenige produzierende Unternehmen, die „ansprangen“ und schutzrechtsfähige Standardprodukte in die Welt verkaufen. Wir haben keinen neuen Steve Jobs und keinen neuen Karl Lagerfeld. Und erst recht keine neuen Produktionsstätten mit vielen Arbeitsplätzen. Jedenfalls keine, die das Ergebnis der Berliner Wirtschaftsförderpolitik wäre.
Doch seit einigen Tagen gibt es hier eine neue „Agenda“: Zurück zur Industrie. Oder, als Imperativ und mit Link zur Vergangenheit:
Kreative in die Industrie!
„Hauptstadt im Gespräch“
Vor einigen Tagen hat der aus seiner Lethargie erwachte Wirtschaftssenator Wolf (Linkspartei) einen „Masterplan“ veröffentlicht. Darin drücken die üblichen Verdächtigen von IHK, „Netzwerken“, Wirtschaftsförderungen etc. aus, was Berlin „jetzt“ braucht und dass Berlin „alle Chancen hat“. Man hat aber auch nichts verpasst, wenn man dieses Pamphlet nicht gelesen hat.
Am Samstag, 05. Juni, hingegen fand im Charlottenburger Ludwig-Erhard-Haus die zweite „Berliner Ideenkonferenz“ der SPD statt. Motto: „Neue Industrialisierung – Nachhaltiges Arbeiten und Wirtschaften“.
Dort fielen Stichworte, die ich vor Jahren vergeblich versuchte, in der Berliner FDP zu etablieren. Aber heute ging es los. Heute war, um bescheiden anzufangen, die Rede von AEG als Blaupause für Apple, weil schon der alte Rathenau wusste, dass man neuartige Produkte besonders kundenfreundlich gestalten muss, damit sie von Kunden angenommen werden. (Das stimmt: die alten Dreh-Lichtschalter im Keller waren den Drehschaltern nachempfunden, mit denen man davor die Gasleitung für die Beleuchtung aufdrehte.)
Auf dem Podium tummelten sich ein Wirtschaftsprofessor, ein Berater für Wirtschaftsförderung, der Manager des Technologiezentrums Adlershof und sogar eine echte Unternehmerin: Gabi Grützner von der micro resist GmbH. Sie ist auch Beirätin für Mittelstand beim Wirtschaftssenator..
Zuerst befürchtete ich, dies sei wieder mal eine Veranstaltung, bei denen sich die nicht wenigen Angestellten der Wirtschaftsförderung, Landesbank, Stadtmarketing, IHK und öffentlich finanzierten „Netzwerkkoordinatoren“ gegenseitig Vorträge halten und Kaffee und Kekse anbieten. Aber das war doch etwas anders, besser:
Denn während die Philosophie vieler Teilnehmer sonst lautet: „Hauptsache, man wird nichts gefragt“, war das Publikum ausdrücklich zu Ideen und Fragen aufgerufen. Außerdem hatte man mit Christian Stahl einen schlagfertigen Moderator.
Unverzichtbar: Die nacheilenden Propheten von McKinsey
Das Opening besorgte McKinsey mit der sensationallen Erkenntnis, dass Berlin „mehr kann“. Modellstadt für -Achtung: Sensation- Elektromobilität sein zum Beispiel. Berlin sei hier im Wettbewerb mit dem Ruhrgebiet und Singapur. Man müsse „jetzt“ etwas tun.
Ich hatte genau das der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt schon mal vor zwei Jahren vorgeschlagen. Antwort damals: Elektroautos sind zu leise. Die schleichen sich an Fussgänger ran und fahren sie dann um. Außerdem sind die noch völlig unterentwickelt. Sagte mir damals eine wissenschaftliche Angestellte aus der Senatsverwaltung. Wenn nun aber McKinsey das gleiche schreibt und fordert, ist das etwas ganz anderes. Dann ist das professionelle Kreativität aus gutem Hause.
Der Technozentrumsmanager
Der Adlershofer Manager lobte McKinsey ausdrücklich dafür, dass die sich mal „hingesetzt und nachgedacht“ hätten. Das erinnerte mich an die Art, mit der sich Wolfgang Schäuble neulich bei Josef Ackermann für dessen „Engagement“ in Griechenland bedankte…
Der Volkswirt
Der Professor für Volkswirtschaft griff als nächstes das Bild vom Kreativen mit Laptop im Cafe auf, um zu verdeutlichen, dass die neuen Industrien nicht mehr mit großen Hallen und Schornsteinen daher kommen.
Die Unternehmerin
Worauf ihm die Unternehmerin Grützner später erwiderte: „Ich habe schon lange nicht mehr mit einem Laptop im Cafe gesessen habe. Ich muss eigentlich andauernd irgendwelche Aufgaben und Probleme lösen und finde nie Zeit, mit meinem Laptop im Cafe zu sitzen.“
Sie wies darauf hin, dass achtzig Prozent der Berliner Unternehmer weniger als fünfzehn Mitarbeiter haben. Und dass es angesichts des niedrigen Gehaltsniveaus in Berlin schwierig sei, Hochschulabsolventen und ausgelernte Azubis im Unternehmen zu halten. Viele wanderten einfach ab nach Süddeutschland. Kreativität sei auch wichtig, aber zum Handwerkszeug fürs Wachstum gehöre mehr. Denn jedes neue Produkt müsse aus einer erfolgreichen Cash-Kuh finanziert werden.
Kapital? Kein Bedarf
Da fiel mir eine Diskussion aus meinem sozialliberalen Gesprächskreis im Grunewald ein. Ich meldete mich am Mikro: „Ich wundere mich, warum das Stichwort Kapitalbedarf und Unternehmensfinanzierung noch nicht genannt wurde.“ Einwurf vom Moderator: „Sie meinen, nach all den unrealen Zockereien jetzt mal in was Reales investieren?“ – Und ich so: „Genau: Warum kann ich als Berliner nicht in Berliner Startups investieren? Warum werden hierfür nicht mal Fonds aufgelegt und Foren für Anleger und Existenzgründer organisiert?“.
Heftiges Kopfnicken bei der McKinsey Beraterin. Doch Kopfschütteln bei der Unternehmerin. Wie bitte? „Nee, ich kann Ihnen nur raten: Bleiben Sie selbstbestimmt! Holen Sie sich keine Mitbestimmer ins Haus. Die Berliner Banken haben während der Finanzkrise alle weiter gut funktioniert und den Berliner Mittelstand mit Krediten versorgt. Die IBB hat die 250.000 Euro Startdarlehen aufgelegt und die Mikrokredite. Funktioniert alles gut.“
Woran es wirklich hapert
Was ihr viel Dringender fehle seien gute Vertriebsmitarbeiter. Das wiederum wusste ich seit fünf Jahren, als ich mit der IHK Frankfurt/Oder und Professor Fricke von der TFH Wildau mal eine Vertriebs- und Marketinginitiative für Technologieunternehmen organisiert hatte. Da waren wir auch mal in ihrem Unternehmen zu Gast.
Da war ich baff. Mein im Kern immer noch liberales (aber eben sozialliberales) Weltbild ein wenig erschüttert. Dem Berliner Mittelständler fehlt es nicht an Kapital oder Krediten. Die McKinsey Beraterin sagte mir später in der Pause, solche Fonds gebe es inzwischen. Man könne hin und wieder im -nächste Überraschung:- Tagesspiegel davon lesen, oder Werbung sehen.
Was Frau Grützner von der Berliner Politik erwarte, waren nur zwei Dinge: Erstens, werdet schneller. Sie könne selten so lange warten, bis die Politik etwas entschieden habe. Und man werfe im Bezirk nicht alle Regeln um, wenn mal der Bürgermeister wechselt. Und zweitens: Lasst Euch was einfallen, womit Ihr die jungen Leute in Berlin haltet. (Wenn man das so liest, wundert man sich: Ich dachte immer, vor allem die Jugend ziehe es nach Berlin..).
Mein Zwischenresüme, bevor der SPD-Landesvorsitzende Müller- zum „Hard Talk“ (Konfrontationsinterview) musste: Die neue Industrialisierung kommt sehr sozialdemokratisch daher. Die Berliner Unternehmer wollen kein Fremdkapital mehr und leiden nicht unter Kreditklemmen. Sie erwartet von der Politik, dass die Verwaltung schneller wird. Und dass irgendwer die Jugend im Lande hält.
Dazu also wurde noch Gastgeber und SPD – Chef Michael Müller interviewt. Er eröffnete mit einem verblüffenden Statement: „Die Politik will sich zurücknehmen, wenn auf dieser Konferenz über Ideen diskutiert wird.“ Klang das nur in meinen Ohren so schwach..? Was er von der McKinsey – Studie halte, nach der Tourismus, Elektroautos und die Pharmazie bis zu 500.000 neue Arbeitsplätze hergäben? Antwort, und das fand ich gut: „Es ist richtig, so einen hohen und konkreten Anspruch zu haben.“ Und außerdem sei es Gerhard Schröder zu verdanken, dass die SPD wieder über Wirtschaft spreche und Kompetenz beanspruche.
Drei dicke Pfunde, mit denen Berlin im Wettbewerb um die neue Industrialisierung wuchern könne, seien die leeren Großflächen inmitten der gewachsenen Großstadt: Tempelhof, Tegel und der alte Humboldthafen, nördlich vom neuen Hauptbahnhof. Richtig. Mit sowas kann das Ruhrgebiet überhaupt nicht dienen.
Elektromobilität? – Nur schienengebunden
Und dann fragte ihn der Moderator, was er denn von Berlin als Modellstadt für Elektromobilität halte. Müller antwortete: „Also, für Entfernungen unter 100 Kilometern muss eigentlich keiner mit dem Auto fahren. Meine Vision ist die einer Großstadt, in der der öffentliche Nahverkehr so gut ist, dass niemand mehr ein Auto braucht.“
Dieses Statement, ein echtes Statement gegen das Auto als Produkt und für Mobilität als Dienstleistung, brachte den größten Applaus auf der gesamten Veranstaltung. Wir waren wieder am Ausgangspunkt des Diskurses angekommen.
 Es ist ein heikles Thema, das immer wieder tabuisiert wurde. Und das aus gutem Grund. Zu schnell haben ewig Gestrige das Thema instrumentalisiert und grenzdebile Parolen geschwungen. Aus Angst vor den Rechten hat die politische Elite daher das Thema vermieden. Nun entpuppt sich diese Strategie als Bumerang: Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen Religionszugehörigkeit und Gewaltbereitschaft.
Es ist ein heikles Thema, das immer wieder tabuisiert wurde. Und das aus gutem Grund. Zu schnell haben ewig Gestrige das Thema instrumentalisiert und grenzdebile Parolen geschwungen. Aus Angst vor den Rechten hat die politische Elite daher das Thema vermieden. Nun entpuppt sich diese Strategie als Bumerang: Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen Religionszugehörigkeit und Gewaltbereitschaft.