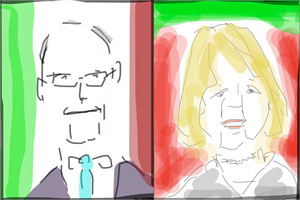Dieser Tage wurde ein weiterer Band von Martin Walsers Tagebüchern veröffentlicht. Dies ist ein Ereignis, das gewöhnlich allenfalls eine übersichtliche Gruppe von Germanisten und Walser-Lesern zu interessieren vermag. Doch diesmal ist alles anders, denn die Aufzeichnungen umfasen die Jahre 1974-1978 und dokumentieren somit einen der berühmtesten Streite der Nachkriegsliteratur: Die Walser-Reich-Ranicki-Debatte.
„Ein belangloser, ein schlechter, ein miserabler Roman“, heißt es in Marcel Reich-Ranickis 1976 in der F.A.Z. publizierten Rezension des Walser-Romans „Jenseits der Liebe“. Es ist der Inbegriff eines Verrisses, der noch heute seinesgleichen sucht. Wo andere Literaturkritiker sich auf ausufernde Inhaltsangaben beschränken, bezieht Reich-Ranicki schonungslos Stellung: „Es lohnt sich nicht, auch nur eine einzige Seite dieses Buches zu lesen“, stellt er fest. Walsers Roman sei nicht „Jenseits der Liebe“, sondern vielmehr „Jenseits der Literatur“: „In dieser Asche gibt es keinen Funken mehr.“
Wer jemals Walsers Roman gelesen hat, stellt fest, dass Reich-Ranicki sich mit diesem Verriss nicht profilieren, sondern lediglich seinem Ärger über dieses Stück missratener Literatur zum Ausdruck bringen wollte. Damals äußerte sich Walser – zumindest nicht öffentlich – zu Reich-Ranickis Verriss. Wie man nun aber den Tagebüchern dieser Zeit entnehmen kann, hat es die Reaktion vom Bodensee-Schriftsteller in sich. Auf mehr als 60 Seiten ergeht sich der spätere Autor der unsäglichen Paulskirchenrede und des mit antisemitischen Klischees spielenden Abrechnungsromans „Tod eines Kritikers“ in Rachephantasien. Aus dem Reich der Literatur ausgewiesen zu werden sei schlimmer als aus seinem Heimatland ausgewiesen zu werden, schreibt Walser und konstatiert: „In unserem Verhältnis bin ich der Jude“.
Hellmuth Karasek, langjähriger Weggefährte von Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki, spricht im Interview mit Philipp Engel über Walsers Narzissmus und dessen antisemitische Reflexe.
Herr Karasek, sind Sie vom Ausmaß der Verletzung überrascht, die Marcel Reich-Ranickis Verriss bei Martin Walser hinterlassen hat?
Wenn man jung ist und selbst rücksichtslos mit seinem Leben umgeht, dann wird einem der Grad der Verletzung, auch bei anderen, nicht in dem Maße deutlich, wie es nachträglich der Fall ist. Für Martin Walser, der die Hoffnung hegte, Großautor der deutschen Literatur zu werden, gab es aber noch eine andere lebensverändernde Enttäuschung. 1960 hatte er den Roman »Halbzeit« geschrieben, der damals von Friedrich Sieburg, Marcel Reich-Ranickis Vorgänger als Literaturchef der FAZ, ungemein negativ besprochen wurde. Diese Kränkung wiederholte sich dann, als Reich-Ranicki »Jenseits der Liebe« rezensierte …
… und als »Jenseits der Literatur« bezeichnete.
Ja, denn Walser wollte sich mit Autoren wie Günter Grass und Uwe Johnson messen, die Literaturwelt erobern. Doch Reich-Ranickis Rezension versetzte Walsers Selbstbewusstsein einen Todesstoß, wollte er doch als eleganter und gleichsam bedeutender Schriftsteller der Bundesrepublik gelten.
An einer Stelle heißt es in Walsers Tagebüchern: »In unserer Beziehung bin ich der Jude.« Wollte sich der ehemalige Wehrmachtssoldat mit einer solchen Täter-Opfer-Umkehr »reinwaschen«?
Ich nehme an, dass er damals tatsächlich dieses völlig überzogene Gefühl hatte. Ein Autor wie Walser kann aus seiner tiefen narzisstischen Kränkung heraus gar nicht erkennen, was für einen gefährlichen Vergleich er da anstellt. Im Warschauer Ghetto, das Reich-Ranicki überlebte, ging es um existenzielle Auslöschung. Es gab keinerlei Gerechtigkeit oder Berufungsinstanz. Dagegen war der Literaturbetrieb der Bundesrepublik doch etwas sehr Kommodes. Walser hatte erfolgreiche Lesungen, sicherlich haben ihm auch die Damen zu Füßen gelegen und ihn angehimmelt. Aber wegen der Kritiken konnte er nicht vollends durchstarten. Die Rezension von Reich-Ranicki war für ihn eine zutiefst narzisstische Kränkung.
»Es ist für einen Schriftsteller schlimmer, aus der Literatur hinausgewiesen zu werden, als aus seinem Land ins Exil, in ein anderes Land vertrieben zu werden«, schreibt Walser.
So kann nur ein völlig überkandideltes Ich empfinden. Tagebücher sind immer maßlos. Dass man das aber nun drei Jahrzehnte später veröffentlicht und in heutigen Interviews auf der damaligen Einschätzung beharrt, zeigt, dass die Wunde immer noch nicht verheilt ist. Das Ganze hat etwas Hanebüchenes. Kein Kritiker wird jetzt »Jenseits der Liebe« noch einmal lesen und sich fragen, ob es zu Unrecht damals vom Tisch gefegt wurde. Ich jedenfalls tue es nicht.
Halten Sie es für möglich, dass Martin Walsers umstrittene Rede in der Paulskirche über die »Moralkeule Auschwitz« und sein Roman »Tod eines Kritikers« Ausfluss der vernichtenden Literaturkritiken Reich-Ranickis waren?
Ich denke, die FAZ hat recht, wenn sie schreibt, dass mit Walsers Rede in der Paulskirche und dem Roman »Tod eines Kritikers« der Korken aus der seit Langem gärenden Flasche geradezu herausgeschossen ist. Und was dabei herauskam – Walser sieht es bis heute nicht ein –, muss man als einen antisemitischen Reflex deuten. Ich habe damals bei der Paulskirchenrede in der Tat gedacht: Das ist die direkte Reaktion auf Reich-Ranickis Verriss von »Ein springender Brunnen«. Und der »Tod eines Kritikers« ist und bleibt, wie Felicitas von Lovenberg mit Recht schreibt, ein fatales Buch.
Das Interview erschien auch in der Wochenzeitung “Jüdische Allgemeine”