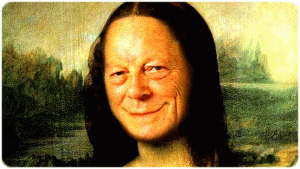Schießereien, im Williamsburg sowie schon weniger als zum Beispiel in Bed Stuy, in der South Bronx oder in Central Brooklyn, wurden nach dem Zuzug der mutigen jungen und meistens engagierten Leute im Williamsburg zur absoluten Seltenheit.
Schießereien, im Williamsburg sowie schon weniger als zum Beispiel in Bed Stuy, in der South Bronx oder in Central Brooklyn, wurden nach dem Zuzug der mutigen jungen und meistens engagierten Leute im Williamsburg zur absoluten Seltenheit.
Es gab weiterhin die No-No-Go Arreas, aber die Stadtteilbereiche außerhalb dieser besonderen Risikozonen wurden immer sicherer. Die Hot-Zones wurden sozusagen eingehegt und ansonsten weiter systematisch gemieden. Die leeren Häuser wurden mit Hilfe der Stadt, die mittlerweile für all diese Viertels Hilfsprogramm aufgelegt hatte, entweder ganz abgerissen oder renoviert und neu bewohnt. Da, wo nur leere Brachen überblieben wurden Nachbarschaftsgärten angelegt und/oder Selfmade-Autoreparaturen und Ersatzteillager errichtet.
Diese Grundstücke, auf den vorher halb abgebrannte Häuser standen, gehörten in der Regel sowieso der Stadt, weil in New York jedes Grundstück samt Haus ins öffentliche Eigentum ohne Entschädigung überführt wird, wenn mehr als 3 Jahre dafür keine Grundsteuer bezahlt wird. So konnten die Nachbarschaftsgärten auch offiziell den Bewohnern überlassen werden. Das gleiche galt für die leer stehenden Häuser, die von den Bewohnern in Selbsthilfe renoviert werden konnten. Die örtlichen Kirchen unterstützen solche Menschen mit Baumaterial und Expertenwissen.
Die Kreativen-Community passte in dieses Selbsthilfe-Konzept bestens hinein, denn sie verdrängt zu diesem Zeitpunkt niemanden und waren sogar Vorbild für die nun sich immer stärker entwickelnde Eigeninitiative der Bewohner.
Den eigentlichen künstlerischen Aktivitäten stand die lokale Mehrheitsgesellschaft jedoch eher skeptisch bis gleichgültig gegenüber. Auch den Szenekneipen und Galerien die mit der Phase der Szenebildner in den Stadtteil kamen. Aber auch die besetzen Leerstände und belebten damit das Viertel weiter. Im Gegensatz zu den Galerien und Künstlerstudios/Lofts waren die neuen Restaurants auch für die Polen und Latinos interessant. Zumindest für die, die sie bezahlen konnte, was nicht so schwierig war, weil die Preise dort noch erschwinglich waren.
Obendrein nahm die Arbeitslosigkeit in Williamsburg langsam aber sicher ab, weil die ganze Stadt, ja die gesamten USA wieder Jobs für die Unterschicht anzubieten hatte. Es kamen die sogenannten golden Jahre der Gentrification, denn alle im Stadtteil hatten in dieser Phase etwas davon. Die Zugezogenen genauso wie die, die es in der Krise dort aus- und durchgehalten hatten. Der Stadtteil wurde nicht nur immer sicherer sondern auch immer interessanter und vor allem ordentlicher. Der Müll auf den Straßen verschwand vollständig, es gab keine hohlen Fenster und Türlöcher mehr, und da wo es sie noch gab, da waren auf einmal ordentliche Zäune drum herum oder sogar Baugerüste die auf baldige Renovierung hinwiesen.
Die älteren Bewohner saßen wieder, wie früher, bei angenehmem Wetter auf der Treppe vor dem Haus. Auch nach dem es dunkel geworden war. Die jungen Leute saßen vor ihren immer noch etwas schmuddelig aussehenden ehemaligen Lagerhäusern und Fabriken, oder auf deren Dächern und schwätzten bis tief in die Nacht. Die Straßen der Latinos waren in den warmen Sommernächten wieder voller Salsa Musik zu der gerne auch auf der Straße getanzt wurde. Es gab sogar wieder eine kleine Stadtteil-Salsoteca in der man fantastische Bands hören konnte. Beim Zuhören und dazu tanzen blieben die Latinos aber vorerst unter sich. Wie in ihren öffentlich und/oder kirchlich geförderten Kultur- und Sozialklubs.
Aber auch die jungen mehrheitlich weißen Zuwanderer brachten ihre Musik mit. Die ersten House-und Punk-Clubs entstanden aus privaten Roof- und Loftparties. Später kam Jazz und Rock dazu. Es war zunehmend, so sagten mir die Eingeweihten, wie in den Siebzigern in der Lower East Side in Manhattan. Damals war es da auch noch billig und sehr bunt. Es erschien ihnen so, als wäre das ganze East Village über das Wasser nach Brooklyn gesprungen. Es war auch das gleiche Aufbruchsgefühl. Nur dass die Leute jetzt viel jünger waren. Das konnte man zunehmend auch auf den Straßen von Williamsburg sehen.
Jugend und Aufbruch gingen hier Hand in Hand. Die, die dazu kamen waren immer noch jünger, als die die schon ein paar Jahre an diesem Ort auf dem Buckel hatten, und damit kam auch der neue Style. Das was später als LoFiBo-Mode in die Welt ging, wurde in Williamsburg, so sagen zumindest die Lokalpatrioten, geboren und die Bedford Avenue wurde von der immer belebter werdenden Hauptstraße zugleich auch zum dazu gehörigen Laufsteg. Und aus Williamsburg wurde im Szenesprech „W-Burg“ oder auch „L-City“.
Den Ursprung dieser Low-Finance-Bohemien Couture hatte ich noch selbst erlebt. Es war ein riesiges Lagerhaus an der Kent Avenue, der letzten Straße vor bzw. entlang der Waterfront, in dem man Kiloweise Second-Hand-Klamotten kaufen konnte. Zu einem Spottpreis, was vor allem meine weiblichen Studenten, nach dem sie diesen Schuppen entdeckt hatten, dazu brachte, regelmäßig mit dem doppelten Gepäck nach Hause zu fahren bzw. zu fliegen.
Da war dieser Laden noch ein absoluter Geheimtipp. Die neuartige, ungewohnte bis abgefahrene Zusammenstellung alter Kleidungsstücke zu einem eigen ganz individuellen Street-Style, garniert mit Kuriositäten aus der Welt der Kurz- und Schmuckwaren der preiswerten Machart wurde Jahre später zu einer Art öffentlichem Wettbewerb auf W-Burgs Sidewalks.
Die Gründung eigener klitzekleiner Modelabels war danach fast unvermeidlich und die billigen Räumlichkeiten gab es ja immer noch. Zu den Kneipen, Restaurants und Clubs gesellten sich nun auch die ersten Boutiquen mit Minischneidereien und die ersten anspruchsvollen Geschäfte für Design-Gebrauchtmöbel. Und die erste Stadtteilzeitung die darüber berichtete. Mittlerweile sind es deren 3 oder 4. Eine davon schon seit vielen Jahren nur mit hoch literarischen Texten . Alle Zeitungen sind umsonst, sprich durch Anzeigen finanziert.
Die erste Buchhandlung kam weit vorher. An der Bedford Ecke North 5th. Zuerst auch nur mit gebrauchten Kunstbüchern. Danach dehnte sie sich Stück für Stück aus und man konnte dort auch neue Bücher bestellen. Um eine wirklich große Auswahl von Geschriebenem und/oder Bebilderten zu bekommen musste und muss man aber nachwievor rüber nach Manhattan.
Sehr empfehlenswert Barnes & Nobles am Union Square. Oder was das Buchantiquariat betrifft, nicht weit davon entfernt am Manhattan Broadway „Strands“. Auch die Künstlerhardware ist in Manhattan nach wie vor unübertroffen konzentriert. Galerien gibt es jedoch in Williamsburg mittlerweile so viele, dass es mindesten einen Tag braucht, nur um sie alle gesehen zu haben.
Verglichen mit Manhattan ist das allerdings immer noch absolut lächerlich. Dort gibt es allein im Stadtteil Chelsea 600 davon. Im W-Burg gibt es mittlerweile um die 70 wobei die Schallmauer 100 in naher Zukunft erreichbar erscheint. Deswegen haben sich die Galerien schon seit längerem auch zu einer eigenen unabhängigen Selbstförderungsorganisation zusammen geschlossen. Aber das geschah erst als die Zeit der Scene-Builder dem Ende zu ging und die Phase der Scene-Seekers begann.
Scenebuilding ist zu einem großen Teil Unternehmensgründung und Professionalisierung. Aus Hobbys und Selbstausbeutung, aus Leidenschaft und Wahnsinn werden richtige Jobs die ihre Inhaber auf Dauer ernähren. Mit vielen Flops aber auch mit zunehmenden Erfolgen. Dazu braucht es jedoch auch genug Kunden und Abnehmer und vor allem Produkte die es woanders in der Stadt nicht gibt. Das ist in einer Stadt wie New York nicht so einfach. Dazu braucht es die kritische Masse in der Vielfalt und der Menge der Angebote, die sogenannte Take-Off-Geschwindigkeit in der Entwicklungsdynamik der Gentrification.
Das hängt eng mit dem Sceneseeking selbst zusammen, weil die Kunden aus der eigenen kreativen Community und der sonstigen Nahbereichsbevölkerung nicht ausreichen, um den eigenen Laden auf Dauer tragfähig zu machen. Es müssen mehr davon aus der Rest-Stadt und darüber hinaus kommen, die Sceneseekers eben. Die die genau solche Szeneviertel mögen und gerne dort konsumieren, zumindest aber sich regelmäßig und gerne dort aufhalten. Es galt also die restlichen „Brooklinites“, vor allem aber die „Manhattanies“ zu „erobern“ bzw. anzulocken.
Dazu mehr in der nächsten Folge.
Was bisher geschah:
Die Willamsburg Story I…Klack
Die Willamsburg Story II…Klack
Die Willamsburg Story II…Klack
Die Williamsburg Story IV…Klack

 Bildung: Förderunterricht für Migrantenkinder gestrichen…
Bildung: Förderunterricht für Migrantenkinder gestrichen…
 Hier ist der dritte Teil unserer Online-Ausstellung mit Werken von
Hier ist der dritte Teil unserer Online-Ausstellung mit Werken von  Bochum kann sich das Konzerthaus nicht leisten und wahrscheinlich werden nicht alle Theater im Ruhrgebiet die nächsten Jahre
Bochum kann sich das Konzerthaus nicht leisten und wahrscheinlich werden nicht alle Theater im Ruhrgebiet die nächsten Jahre An der Bedford gab es mit der Ausnahme von zwei kleinen öden Bierkaschemmen keine Kneipe weit und breit. Vom christlich-polnischen Greepoint bis zum jüdisch orthodoxen Viertel südlich der Williamsburg Bridge gab es außer Peter Lugers nur eine einzige ernst zu nehmende Bar: das Teddys.
An der Bedford gab es mit der Ausnahme von zwei kleinen öden Bierkaschemmen keine Kneipe weit und breit. Vom christlich-polnischen Greepoint bis zum jüdisch orthodoxen Viertel südlich der Williamsburg Bridge gab es außer Peter Lugers nur eine einzige ernst zu nehmende Bar: das Teddys.  Antisemitismus: Bedingungslos für Israel?…
Antisemitismus: Bedingungslos für Israel?…