 Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich zum ersten Mal nach Williamsburg kam. Es war im Sommer 85 an einem dieser feucht-heißen „Nothing is hotter than July“ Tagen. Die damals ziemlich runter gekommenen Waggons der JMZ-Linie, auf der NYC-Subway-Map auch heute noch braun eingezeichnet, hielten kreischend an der ersten Station in Brooklyn. Sie waren, vollgepackt mit mehrheitlich farbigen, eher ärmlich gekleideten Passagieren, durch das Stahlgestrüpp der Williamsburg-Bridge über den East River gekrochen um danach auf einer aufgeständerten Schienenkonstruktion in einem knappen Bogen über dem Broadway zu landen. Ja, Brooklyn hatte zu meinem Erstaunen auch einen Broadway und der führt tief ins Innere dieses Mehr-Millionen-Boroughs, der vor der Eingemeindung nach New York City die viertgrößte Stadt der USA war.
Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich zum ersten Mal nach Williamsburg kam. Es war im Sommer 85 an einem dieser feucht-heißen „Nothing is hotter than July“ Tagen. Die damals ziemlich runter gekommenen Waggons der JMZ-Linie, auf der NYC-Subway-Map auch heute noch braun eingezeichnet, hielten kreischend an der ersten Station in Brooklyn. Sie waren, vollgepackt mit mehrheitlich farbigen, eher ärmlich gekleideten Passagieren, durch das Stahlgestrüpp der Williamsburg-Bridge über den East River gekrochen um danach auf einer aufgeständerten Schienenkonstruktion in einem knappen Bogen über dem Broadway zu landen. Ja, Brooklyn hatte zu meinem Erstaunen auch einen Broadway und der führt tief ins Innere dieses Mehr-Millionen-Boroughs, der vor der Eingemeindung nach New York City die viertgrößte Stadt der USA war.
Über diesem „Broadway für Arme“ scheppert und knirscht bis heute mit ohrenbetäubendem Lärm über viele Kilometer eine der längsten U-Bahnlinien der Stadt hinaus nach Jamaika Center. Fährt man sie in die andere Richtung dann geht es mit ihr über Downtown Manhattan wieder nach Brooklyn bis fast an den Atlantik.
Die Williamsburg Bridge die zu diesem Zeitpunkt, wie die Queensborough Bridge noch heute, vor Rost nur so strotze, ist eine der schönsten Brücken der Stadt. Komplett aus zigtausenden Stahlstäben gebaut die mit Abermillionen von Nieten zu einem gut 2km langen Ingenieurkunstwerk zusammengesetzt worden sind, ist sie nach gut 20 Jahren Reparaturzeit und fast eine Milliarde Dollar Material- und Arbeitskosten jetzt wieder in einem fast neuen Zustand. Sie verbindet Williamsburg mit der Lower-Eastside in Manhattan, damals noch „Loi Saida“ genannt, weil sie zum größten Teil von Latinos bewohnt wurde. Wie zu diesem Zeitpunkt auch ein großer Teil ihres städtebaulichen Gegenübers namens Williamsburg in Brooklyn.
Ihre fußläufige Überquerung galt in der Dunkelheit als lebensgefährlich. Tagsüber war sie die „Poor-People-Bridge“, denn sie wurde vor allem von Leuten begangen die sich nicht mal die U-Bahn leisten konnten, aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit nach Manhattan mussten. Wer genug Geld hatte nahm sich nachts ein Taxi über die Brücke und musste sich daran gewöhnen, dass der Fahrer wie automatisch die Sicherheitsknöpfe der Türen betätigte, wenn er ihren Scheitelpunkt passierte.
Manche, in der Regel weiße, Fahrer weigerten sich zu diesem Zeitpunkt sogar überhaupt über die Brücke Richtung Brooklyn zu fahren. Sicherheitshalber nahm man sich einen der schwarzen Chauffeure weil die, bis heute, in der Regel überall hin fahren. Seit einigen Jahren gondeln allerdings alle Cabdriver gerne über die Brücke, weil auf der anderen Seite statt Gefahr eine Menge Touren auf sie warten. Williamsburg ist mittlerweile eines der hippsten Stadtteile vom ganzen Big Apple. Mit Sicherheit aber zur Zeit neben Brooklyn Hights der bekannteste Neighbourhood in Brooklyn.
Was die internationale Kunstszene betrifft, gilt dieser Stadtteil seit der Jahrtausendwende sogar als Must Go Arrea. Als ich dort an diesem Tag zum ersten Mal auftauchte wäre das dort niemand auch nur im Traum eingefallen. Dabei hatte mich ein Künstler dorthin eigeladen, den ich ein paar Tage vorher auf eine Party in Manhattan kennen gelernt hatte und der in den folgenden Jahren ein guter Freund wurde. Er hatte mich allerdings vorgewarnt. Ich sollte möglichst von der U-Bahn aus direkt den Bus benutzen, sprich möglichst wenig zu Fuß gehen.
Das Drive-By-Shooting war zu dieser Zeit in bestimmten Stadtteilen New Yorks bei Drogendealern gerade in Mode gekommen und Williamsburg gehörte dazu. In solchen Fällen hatte man sich nach dem ersten Schuss sofort flach auf den Boden zu werfen und, wenn Kinder dabei waren, diese fest an sich, ja noch besser unter sich zu drücken. Das geschah nicht täglich, aber einmal im Monat konnte man fest damit rechnen, und man wusste nie genau wo. Überfälle waren dagegen in solchen Stadtteilen wie Williamsburg an der Tagesordnung. Aber auch hier gab es Regeln. Geld abgeben und Fresse halten. Kein Versuch sich zu wehren. Keinen einzigen!
Besser war es auch, immer etwas Geld dabei zu haben. Die Superdroge Crack hatte zu diesem Zeitpunkt die Stadt in den Griff zu nehmen begonnen und die Jungs- und Mädels die dringend neuen Stoff brauchten waren nicht zimperlich, wenn es bei den Überfallenen gar nichts zu holen gab. Sie waren selbst für Leute die sich an den Straßenraub gewöhnt hatten nicht mehr einzuschätzen.
Also nahm ich treu den Bus und als ich in der Nähe des uralten Fabrikgebäudes ausstieg, in dem S. wohnte hatte ich gehörigen Schiss. Müll auf der Straße. Jedes dritte Gebäude war zugenagelt oder nur zum Teil bewohnt. Aber die Leute in den Straßen machten nicht den Eindruck, dass sie mich gleich überfallen wollten. Sie waren jedoch sichtlich erstaunt, dass sich ein gut gekleideter Weißer in ihre Gegend wagte.
Ich traute mich nicht nach dem Weg zu fragen und fand, weil ich das New Yorker Straßensystem mittlerweile durchschaut hatte, selbst zur Berry Street Ecke South Third. Ich nahm den kürzesten Weg, was eingeweihte in solchen Stadtteilen nicht unbedingt tun, und zwar genau weil sie sich dort gut auskennen. Zu jeder No-Go-Arrea gehörten nämlich noch die No-No-Go Bereiche, die aber meistens nur einen einzelnen Block oder sogar nur eine Block-Straße oder -Ecke ausmachten. Davon gaben es in Williamsburg einige und einer davon genau da wo ich her spazierte. Aber das Glück ist bekanntlich mit den Anfängern.
Später lernte ich solche Ecken nicht nur in diesem Stadtteil zur riechen bevor ich sie passierte. Über die Monate und Jahre konnte ich alle sozialen und baulichen Symptome lesen, die die verschiedenen Abstufungen von Gefahr in dieser Stadt sichtbar machten, bevor man so weit drin steckte, dass es wirklich riskant wurde. Ich bin bis heute nicht ein einziges Mal überfallen worden.
Jetzt kann man sich nicht nur durch Williamsburg ohne jede Angst bewegen. Ich habe diesen Wandel von der No-Go- zur Must-Go-Arrea vor allem in diesem Viertel über nun fast 25 Jahre haut nah mit bekommen, denn ich habe seit 1985 fast jedes Jahr für mindestens 2 Monate dort gelebt. Ich werde in weiteren 9 Folgen darüber berichten, wie in dieser Zeit aus dem verrotteten und gefährlichen Viertel, nur eine U-Bahnstation von Manhattan entfernt, ein heute so genanntes Kreativquartier wurde.
Eines über das mittlerweile auch das weltweite Feuilleton und die Reisemagazine berichten, die allerdings sehr wenig darüber wissen, wie so ein Prozess in Wirklichkeit verläuft und was er für die Leute vor Ort bedeutet.
Foto: jontintinjordan
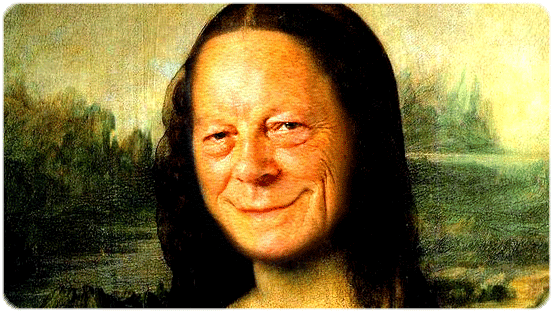


 Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich zum ersten Mal nach Williamsburg kam. Es war im Sommer 85 an einem dieser feucht-heißen „Nothing is hotter than July“ Tagen. Die damals ziemlich runter gekommenen Waggons der JMZ-Linie, auf der NYC-Subway-Map auch heute noch braun eingezeichnet, hielten kreischend an der ersten Station in Brooklyn. Sie waren, vollgepackt mit mehrheitlich farbigen, eher ärmlich gekleideten Passagieren, durch das Stahlgestrüpp der Williamsburg-Bridge über den East River gekrochen um danach auf einer aufgeständerten Schienenkonstruktion in einem knappen Bogen über dem Broadway zu landen. Ja, Brooklyn hatte zu meinem Erstaunen auch einen Broadway und der führt tief ins Innere dieses Mehr-Millionen-Boroughs, der vor der Eingemeindung nach New York City die viertgrößte Stadt der USA war.
Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich zum ersten Mal nach Williamsburg kam. Es war im Sommer 85 an einem dieser feucht-heißen „Nothing is hotter than July“ Tagen. Die damals ziemlich runter gekommenen Waggons der JMZ-Linie, auf der NYC-Subway-Map auch heute noch braun eingezeichnet, hielten kreischend an der ersten Station in Brooklyn. Sie waren, vollgepackt mit mehrheitlich farbigen, eher ärmlich gekleideten Passagieren, durch das Stahlgestrüpp der Williamsburg-Bridge über den East River gekrochen um danach auf einer aufgeständerten Schienenkonstruktion in einem knappen Bogen über dem Broadway zu landen. Ja, Brooklyn hatte zu meinem Erstaunen auch einen Broadway und der führt tief ins Innere dieses Mehr-Millionen-Boroughs, der vor der Eingemeindung nach New York City die viertgrößte Stadt der USA war.
 Kindesmissbrauch: Dortmunder Grüner für Kirchenaustritt…
Kindesmissbrauch: Dortmunder Grüner für Kirchenaustritt…

 Ein griechischer Arzt aus Duisburg brauchte einen Reisepass. Beim Konsulat in Düsseldorf wollte er ihn beantragen. Dumm für ihn, dass er Fakelaki nicht kannte, griechisch für das Geldtütchen, das auch Beamtenherzen öffnet.
Ein griechischer Arzt aus Duisburg brauchte einen Reisepass. Beim Konsulat in Düsseldorf wollte er ihn beantragen. Dumm für ihn, dass er Fakelaki nicht kannte, griechisch für das Geldtütchen, das auch Beamtenherzen öffnet.