Adam Green, Mittwoch, 7. Juli, Nach Ende des Halbfinales, Gleis 22, Münster, leider keine Karten mehr 🙁
Der Ruhrpilot
 Ruhrgebiet: Revier bekommt direkt gewähltes Parlament…Der Westen
Ruhrgebiet: Revier bekommt direkt gewähltes Parlament…Der Westen
NRW: Keine radikale Schulreform unter Rot-Grün…Ruhr Nachrichten
NRW II: Laumann hält Tür zu Koalition in NRW offen…Der Westen
NRW III: Laschet wendet sich gegen „CDU als Arbeiterpartei“…Welt
NRW IV: Das Bettel-Bündnis…Spiegel
NRW V: Milliarden-Schulden von Rot-Grün…RP Online
Dortmund: Heute erste Infos über Blutanalysen…Ruhr Nachrichten
Essen: Designer feiern sich beim Red Dot Award…Der Westen
Bochum: Fiege Kino Open Air 2010…Pottblog
Umland: Sorpequelle – Zum Ziergarten ausgebaut?…Zoom
Umland II: Miracoli ist fertig!…Freitag
Debatte: Die Bildungsoffensive scheitert bei den Migranten…Welt
Datenschutz: Stoppt die Bundesregierung die Datenkrake ELENA?…Netzpolitik
Rauchen: Wenn Rauchverbot, dann auch bitte Alkoholverbot…Hometown Glory
Rauchen: Die grünen Nannies…Zeitrafferin
Antifa: „Blockaden stärken Nazis“…Jungle World
Schluss mit lustig: Das Rauchverbot kann nur der Anfang sein…
 Eine Koalition von Neospießern hat in Bayern das absolute Kneipenrauchverbot durchgesetzt. Das kann nur der Anfang sein. Auf die Neospießer wartet noch viel Arbeit.
Eine Koalition von Neospießern hat in Bayern das absolute Kneipenrauchverbot durchgesetzt. Das kann nur der Anfang sein. Auf die Neospießer wartet noch viel Arbeit.
Gut 20 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern sind sich sicher, zu wissen, wie man gottgefällig lebt. Angeführt von dem ÖDP-Fremdenführer Sebastian Frankenberger legte sich von Grünen bis zu SPD ein breites Bündnis dafür ins Zeug, dass die rauchende Minderheit nach ihrer Fasson glücklich werden soll. Nach diesem Sieg geht es nicht nur um ein bundesweites Rauchverbot. Weitere Initiativen, die uns den Weg zum puritanischen Leben weisen, müssen nun folgen.
Bodymass-Initiative: Dicke belasten die Gesundheitskassen und beleidigen das ästhetische Empfinden der Schlanken. Und: Dicksein ist ansteckend.
Alkoholverbot: Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Es gibt viele gute Gründe, ihm endlich das Handwerk zu legen. Es wird viel zu viel gesoffen in Deutschland. Von Skandinavien lernen heisst siegen lernen.
Absolutes Drogenverbot: Jahrzehnte haben antiautoritär gesonnene Menschen dafür gestritten, zumindest den Umgang mit weichen Drogen zu legalisieren. Damit muss Schluss sein. Von Deutschland aus darf nie wieder ein Joint ausgehen.
Sportpflicht: Mindestens eine Stunde am Tag. Sport ist sowohl physisch als als psychisch gesund. In der Hausgemeinschaft oder am Arbeitsplatz. Überwachen können das die Nachbarn oder die Kollegen. Das geht ganz unbürokratisch.
Meat is Murder: Fleischesser beschleunigen den Klimawandel, töten Mitgeschöpfe und sorgen dafür, das Nahrungsmittel für Menschen knapp werden, weil auf wertvollen Ackerflächen Futtermittel angebaut werden.
Zu dem Thema: Rauchverbot und Emanzipation, Jungle World
Der Kandidat von morgen und eine Rede von gestern
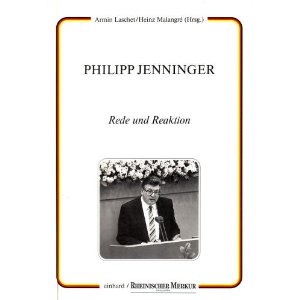
Armin Laschet gilt als Zukunftshoffnung der NRW-CDU. Morgen tritt er gegen Karl-Josef Laumann für den Fraktionsvorsitz der CDU an. Vor gut 20 Jahren aber veröffentlichte der Aachener ein zweifelhaftes Buch über eine skandalöse Rede
Nic Koray
Nic Koray, Dienstag, 6. Juli, 20.00 Uhr, Bam Boomerang, Dortmund
Der Ruhrpilot
 NRW: Der rot-grüne Koalitionsvertrag in NRW steht…Welt
NRW: Der rot-grüne Koalitionsvertrag in NRW steht…Welt
NRW II: Rot-grüne Harmonie am Rhein…Welt
NRW III: Rauchverbot in Bayern – Vorbild für Nordrhein-Westfalen?…Pottblog
NRW IV: Armin Laschet will „schnell besser sein“…Ruhr Nachrichten
Ruhrgebiet: Sparpaket bedroht Städtebau in NRW…Der Westen
Essen: Posen müssen passen…Spiegel
Essen II: Lauschige Familienfeier in Schwarz beim Devilside…Der Westen
Gelsenkirchen: iZOOM App…Gelsenkirchen Blog
Duisburg: Traumzeitfestival – Drei ereignisreiche Tage…Prospero
Umland: Totales Rauchverbot in Bayern beschlossen…Rot steht uns gut
„Der demographische Wandel beginnt jetzt…“
 Der demographische Wandel wird für die Städte zur finanziellen Herausforderung. Experten sind sich einig: Die Städte, die sich jetzt nicht auf den Wandel einstellen, werden die Verlierer von morgen sein.
Der demographische Wandel wird für die Städte zur finanziellen Herausforderung. Experten sind sich einig: Die Städte, die sich jetzt nicht auf den Wandel einstellen, werden die Verlierer von morgen sein.
Gelsenkirchen Ückendorf ist ein Problemstadtteil: Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die meisten Häuser haben schon lange keinen neuen Anstrich gesehen, und in den Ladenlokalen an der einstigen Einkaufsstraße liegt Döner-Bude neben Ramschladen neben Döner-Bude. Geht es nach dem Bochumer Immobilienwissenschaftler Prof. Dr. Volker Eichener, lohnt es sich nicht mehr, öffentliches Geld in Stadtteile wie Ückendorf zu investieren: „Wir müssen einsehen, dass durch den demographischen Wandel viele Stadtteile keine Zukunft haben. Geld, das wir in ihren Erhalt reinstecken, ist rausgeworfenes Geld. Wir müssen die Mittel, die wir haben, in die Quartiere mit Perspektive stecken. Den Menschen, die noch in diesen Quartieren leben, müssen wir an anderer Stelle eine bessere Lebensqualität bieten.“
Um die Immobilienbesitzer davon zu überzeugen, ihre Häuser in Stadtteilen ohne Perspektive aufzugeben, fordert Eichener große Teile der Wohnungsbauförderung in eine Abrissprämie umzuwandeln. Auch in Wachstumsregionen wie Düsseldorf soll künftig auf eine Wohnbauförderung verzichtet werden: „Es ist doch Unfug, dass in Düsseldorf mit öffentlichen Mitteln neuer Wohnraum entsteht“, sagt Eichener, „während ein paar Kilometer weiter in Duisburg immer mehr Wohnungen keinen Mieter mehr finden.“
Das ist auch längst in den guten Lagen Duisburgs der Fall. Zum Beispiel in Alt-Rahm. Der Stadtteil im Duisburger Süden liegt nur wenige hundert Meter von der Grenze zu Düsseldorf entfernt. Ein kleiner Bach mäandert hier neben der Straße. Die Einfamilienhäuser stehen auf großen Grundstücken mit altem Baumbestand. Alt-Rahm gehört zu den besten Wohnlagen des gesamten Ruhrgebiets. Probleme gibt es trotzdem: „Es fällt auch in Alt-Rahm immer schwerer, Käufer für Häuser zu finden“, sagt Jürgen Dressler. Dressler ist Stadtentwicklungsdezernent in Duisburg und ein streitbarer Stadtplaner, der das klare Wort schätzt und dadurch immer wieder aneckt: „Wenn wir selbst im idyllischen Alt-Rahm Probleme haben, wird klar, dass wir in Duisburg und im Ruhrgebiet endlich damit beginnen müssen, uns mit dem Schrumpfen der Städte auseinander zu setzen.“ In Duisburg hat man schon damit angefangen: In Duisburg Bruckhausen werden über 170 Häuser abgerissen. Sie liegen in der Nähe eines Stahlwerks. Die Leerstandsquote ist hoch, und Investitionen lohnen sich nicht mehr. Die Bewohner bekommen neue Wohnungen in anderen Quartieren. Die Auswahl ist groß genug. In den vergangenen 25 Jahren hat Duisburg fast 100.000 Einwohner verloren. Nur noch 492.870 Menschen wohnten Ende 2008 in der Stadt.
Dressler weiß, dass die Menschen vom Abriss ihrer Wohnquartiere nicht begeistert sind. Dass es Widerstand gibt. Und dass man überzeugen muss: „Der Abriss von Quartieren ohne Zukunft ist ohne Alternative. Das betrifft längst nicht nur das Ruhrgebiet. Neben der Emscher-Zone muss auch im Sauerland und im Siegerland längst über solche Maßnahmen diskutiert werden. Die Kommunen müssen die Menschen überzeugen. Das geht nicht ohne Streit, aber wir haben wirtschaftlich keine Alternative. Schrumpfende Städte müssen zurückgebaut werden.“
Das sieht auch Günter Tebbe, bei der Bertelsmann Stiftung für Kommunales Finanzmanagement zuständig, genau so: „Die Städte, die jetzt in den Dialog mit ihren Bürgern treten und nach gemeinsamen Lösungen beim Rückbau der Städte suchen, werden in wenigen Jahren zu den Gewinnern gehören.“
Denn nur, wenn die Städte ganze Quartiere aufgegeben haben, eröffnet sich sie die Chance, sich finanzielle Spielräume zu erhalten. Die werden sie brauchen: „Die Städte müssen mehr in Bildung investieren. Ein Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung kann es sich nicht erlauben, dass fast jeder zehnte Schüler die Schule ohne Abschluss verlässt und jeder vierte nicht über den Hauptschulabschluss hinaus kommt.“
Für die Städte wird sich der demographische Wandel verheerend auswirken. Als Tebbe im Mai die Konsequenzen für Dortmund und Unna vor der IHK östliches Ruhrgebiet vortrug, war nach Meinung eines Teilnehmers das Entsetzen in der Runde groß: „Es sieht wirklich düster aus.“
Für das Ruhrgebiet erwartet die Bertelsmann-Stiftung bis 2025 einen Verlust von 400.000 Menschen. Das entspricht der Größe der Stadt Bochum. Doch der Rückgang ist nur ein Teil des demographischen Wandels: Der Anteil der über 80jährigen wird um über 40 Prozent steigen. „Der Zunahme der Älteren und sehr Alten“, sagt Tebbe, „sorgt nicht nur für höhere Kosten bei der Betreuung und Versorgung.“ Eine älter werdende Bevölkerung hat auch weniger Kaufkraft.
Da mutet es verwunderlich an, wenn im Ruhrgebiet nach einer Studie der IHK Niederrhein die Einzelhandelsfläche seit 2001 um 15,9 Prozent gestiegen ist. Ein Trend, der sich fortsetzen wird: In Dortmund steht ein neues Einkaufszentrum kurz vor der Eröffnung, in Bochum und Recklinghausen wird eifrig an neuen Zentren geplant.
Das Gegenteil wäre richtig: „Es geht künftig um Qualität statt Quantität“, sagt Tebbe. Die Städte müssen Quartiere aufgeben um Infrastrukturkosten zu sparen: Schon weniger Abwasserkanäle, weniger Straßen und mehr Kooperation bei der Verwaltung und im Kultur- und Freizeitbereich helfen beispielsweise, Millionen einzusparen. „Aber es geht nicht nur ums Sparen. Die Quartiere, die erhalten bleiben, müssen attraktiver werden.“ Für Jürgen Dressler eine spannende Aufgabe: „Planung für eine Boomstadt kann jeder. So zu planen, dass eine kleiner werdende Stadt am Ende des Prozesses eine bessere Stadt für die Bürger geworden ist, ist eine Herausforderung.“
Der Artikel erschien in ähnlicher Form bereits in der Welt am Sonntag
Baroness
Der Ruhrpilot
 Bochum: Anselm Weber startet mit Optimismus…Bo Alternativ
Bochum: Anselm Weber startet mit Optimismus…Bo Alternativ
Bochum II: Fans feiern Halbfinale am Palmenstrand…Der Westen
Bochum III: 750 Jahre Knappschaft…Pottblog
Dortmund: Fußballparty läuft in Dortmund bei jedem Wetter…Der Westen
Dortmund II: Stadt will Envio Geschäft in Dortmund verbieten…Ruhr Nachrichten
Essen: Nachdenken über Kultur im Internet…Xtranews
Duisburg: Traumzeit goes Pop…Der Westen
Gelsenkirchen: Sons of Gastarbeita…Hometown Glory
Gelsenkirchen II: Überflutungen in GE…Gelsenkirchen Blog
„Marado Marado, Diego Diego!“
Hoffen wir, dass Deutschland-Argentinien nicht in einem Wettsingen der Trainer entschieden wird.

