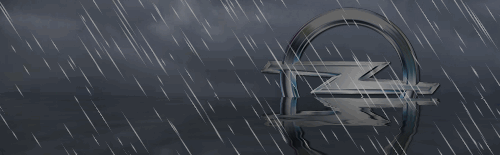Illu: Martin Haase
Illu: Martin Haase
Gestern haben wir bei den Ruhrbaronen drüber diskutiert, ob wir uns heute der Internetmahnwache gegen Familienministerin Ursula von der Leyen anschließen. Eigentlich wollten wir das tun. Dann gab es technische Probleme. Nun, wir haben es nicht getan.
Trotzdem möchte ich was zu der Zensur sagen. Ich finde es erschreckend, wenn das BKA – ohne gerichtliche Anordnung – täglich Proscriptions-Listen mit IP-Adressen an die Provider schickt, die diese zu sperren haben. Das ist Zensur. Nichts anderes. Die Provider Deutsche Telekom, Vodafone/Arcor, Hansenet/Alice, O2 und Kabel Deutschland beteiligen sich damit an den ersten Netzsperren in Deutschland. Bislang war das eine Spezialität aus China. Die Verträge wurden heute unterschrieben.
Natürlich ist es gut und wichtig etwas gegen Kinderpornographie zu tun. Da kann und wird jeder zustimmen. Aber es geht um die Details. Also: Welche Mittel ergreife ich, um diese eklige Form der Ausbeutung zu bekämpfen? Muss ich einer Geheimen Staatspolizei vertrauen, die nach eigenem Gutdünken Publikationen sperrt? Familienministerin Ursula von der Leyen will das tun. Deswegen hat sie sich den Ehrentitel "Zensurulla" bei Netzpolitik.org verdient. Ich meine zu Recht.
Die Freiheit wird nicht in der Mitte verteidigt. Nicht da, wo der allgemeine politische Konsens herrscht. Die Freiheit wird an ihren Rändern gesichert. Deswegen hat Hustler-Chef Larry Flynt Recht bekommen, als er sich bei der Verteidigung seiner Porno-Satiren in den USA auf die Freiheit des Wortes berief.
Natürlich ist ein Kinderporno nicht das gleiche wie eine Hustler-Satire. Aber auch hier gilt es die Freiheit am Rand zu verteidigen. Gegen diese ganzen Kinderschänderbanden muss die Polizei und der Staat vorgehen. Die Ermittler müssen die Verbrecher identifizieren und strafen. Warum aber dazu einfach IP-Adressen per Dekret versiegeln. Die Gangster tauschen sich dann per Telefon aus.
Stattdessen sehe ich eine Gefahr des Dammbruchs. Wer garantiert uns, dass nicht als nächstes eine Terrorseite gesperrt wird? Auch da herrscht sicher große Einigkeit drüber, dass diese Seiten Schund sind.
Wer garantiert uns aber, dass aus der angeblichen Terrorseite schleichend eine Seite Andersdenkender wird? Was weiß ich, zum Beispiel die Seite Linken-Kinder-Wanne-Eickel.de oder so? Wer garantiert uns, dass die Staatsbeamten im BKA selber festlegen wollen, was legal ist und was nicht?
Wann landet dann der erste Blog auf der Staatsfeind-Liste, weil er sich gegen die Fahndungsmethoden des BKA wendet, oder enthüllt, dass ein BKA-Spitzenbeamter sich am Anti-Terrortopf bereichert?
Die Grenzen der Freiheit werden derzeit überall eingeschränkt. Sei es durch den Gerichtsbeschluss gegen die angebliche kriminelle Aids-Ansteckung durch die No Angels-Sängerin, sei es durch die Urteile in Hamburg, die versuchen kritische Veröffentlichungen in Wirtschaftssachen zu unterbinden.
Wir müssen uns bewusst werden, dass gerade im Schund die Grenzen der Freiheit definiert werden. Wenn wir nicht mehr sagen dürfen, dass eine prominente Frau womöglich absichtlich einen Menschen zutiefst verletzt hat – was dürfen wir dann sagen?
Die Zensur beginnt immer aus dem politischen Konsens der Mitte heraus gegen die Ränder und ist dann schwer einzugrenzen. Denn wer ein Blatt zensiert, will früher oder später das ganze Buch kontrollieren.
Nur wenn wir aber alles frei sagen und denken dürfen, sind wir eine freie Gesellschaft. Und dann können wir uns an den Rändern abgrenzen.
Und im Fall der Kinderschänder eben mit dem Strafgesetzbuch gegen die Dreckskerle vorgehen.
Es bringt nichts, in Deutschland eine Zensurbehörde einzuführen, die uns die Augen verschließt. Denn auch wenn wir den Schund nicht mehr sehen, es gibt ihn weiter.
Es wäre also klüger, die IP-Adressen zu nutzen, um die Verbrecher an der Quelle anzugreifen. Wenn dann eine Seite ausfällt, weiß man wenigstens, dass eine Drecksbande erlegt wurde. Beim Zensur-Abschalten muss ich aber befürchten, dass die Ermittler Scheintätigkeiten vortäuschen, weil sie den Menschen die Augen verkleben wollen. Dahinter wird der Schmutzhandel weitergehen.
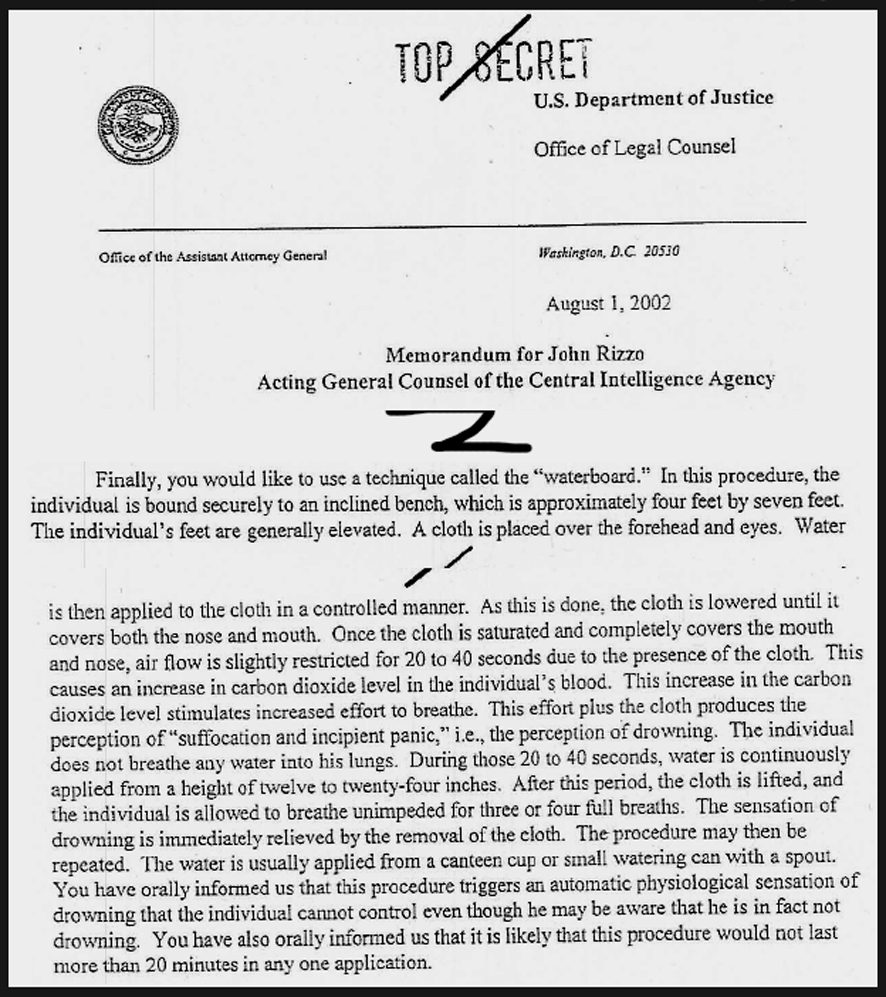




.jpg)