
Mit fünf Millionen Einwohnern nennt sich das Ruhrgebiet gerne eine Metropole. Betrachtet man den Öffentlichen Personennahverkehr, bleibt von dieser vollmundigen Behauptung kaum etwas übrig.
Der Nahverkehr im Ruhrgebiet ist eine Katastrophe. Er ist teuer, schlecht und seine Strukturen sind kompliziert. Über lange Zeit haben gleich drei Verkehrsverbünde den schienengebundenen Nahverkehr, also vor allem das S- und Regionalbahn-Netz des Reviers, geplant und zumindest in ihrem Sprengel für gemeinsame Tarife gesorgt. Neben dem VRR waren das noch der Verkehrsgemeinschaft Ruhr Lippe und die Verkehrsgemeinschaft Niederrhein GmbH (VGN)
Mittlerweile wachsen zumindest VRR und VGN zusammen – eigene Tarife gelten am Niederrhein und im Kreis Wesel jedoch weiterhin. Der Kreis Unna und Hamm sind weiter außen vor. Bei der Reduzierung der Verkehrsverbünde von neun auf drei in NRW, inititiert durch das neue ÖPNV-Gesetz, standen allerdings von vornherein nicht die Interessen der Fahrgäste im Zentrum: So konnten die Städte und Kreise selbst entscheiden, welchem Zeckverband sie sich anschließen, und auch das Recht der Städte und Kreise, weiterhin den Nahverkehr nach dem Kirchturmprinzip zu betreiben, wurde nicht angerührt: „Auf diese Weise sollen tradierte, regionale Besonderheiten in den größer werdenden Kooperationsräumen gewahrt bleiben.“, so das Verkehrsministerium. Allerdings behält sich das Land vor, ein Netz von Schienenverkehrsverbindungen zu definieren, die im landesweiten Interesse stehen. Ein Beispiel dafür wäre der Rhein-Ruhr-Express, für den die Planungen laufen, dessen Realisierung jedoch noch nicht absehbar ist. Die Zweckverbände im Land entsprechen jedoch nicht der vom Land lauthals verkündeten Struktur: Weder wird der Ballungsraum Rhein-Ruhr noch werden die Ballungsräume Ruhrgebiet und Rheinland als eine verkehrsplanerische Region wahrgenommen – für sie alle sind weiterhin mehrere Verkehrverbünde zuständig.
Die Folgen dieser Politik sind in NRW an fast allen Orten zu spüren: in einzelnen Großstädten funktioniert der Nahverkehr gut, aber schon die Verbindung der Nahverkehrsnetze der einzelnen Großstädte ist dürftig bis überhaupt nicht vorhanden. Die Verbindung der ländlichen Räume mit den Ballungsgebieten ist schlecht – was keine Besonderheit NRWs ist, sondern ein bundesweites Problem. Tragisch für das Ruhrgebiet ist allerdings, dass der Nahverkehr innerhalb seiner Grenzen zum Teil auf das Niveau friesischer Landgemeinden sinkt: Schon Städte wie Herten, Haltern, Marl oder Gladbeck leiden nicht nur unter einer geringen Dichte des Netzes in der Stadt, sondern auch unter der zum Teil erbärmlichen Anbindung an andere Städte.
Für Lothar Ebbers, Pressesprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn, ist einer der Gründe die strikte Aufgabentrennung zwischen dem VRR, der zumindest für einen großen Teil des Ruhrgebiets und des Rheinlands das Grundgerüst aus Bahnverbindungen plant und den Städten, in denen Kommunalpolitiker entscheiden, welche Strechen eingerichtet werden und welche nicht: „Es fehlt der Blick auf die Region. Kommunalpolitiker haben nur selten ein Interesse daran, dass die Bürger ihrer Städte optimal an die Nachbarstädte angeschlossen sind – sie befürchten Kaufkraftabwanderungen.“
Und so kann sich der S-Bahn Nutzer, der in Gladbeck West aussteigt, ziemlich sicher sein, dass dort kein Bus auf ihn wartet und auch die Übergänge zwischen den Stadtbahnsystemen von Duisburg und Mülheim funktionieren nicht – weil die Takte nicht aufeinander abgestimmt sind. Beispiele wie diese gibt es im Ruhrgebiet zu hunderten. Politischer Widerwille und wohl auch Inkompetenz bei den Fahrplanverantwortlichen der zahlreichen Nahverkehrsgesellschaften im Ruhrgebiet (Thema des nächstes Artikels) gehen hier ein Allianz ein, für die der Bürger zahlt.
Pro Bahn forderte daher während der Beratungen des neuen ÖPNV-Gestzes die Kompetenzen des VRR zu erweitern – und konnte sich damit beim Land nicht durchsetzen, das weiter das hohe Lied der Eigenständigkeit der Kommunen sang: „Die Städte können ruhig über die Buslinien innerhalb ihrer Grenzen entscheiden, aber immer wenn es um Verbindungen mit regionaler Bedeutung geht, um die Verbindungen zwischen Bus- und Bahnnetz muss der VRR das Sagen haben. Es darf an den Grenzen keine Brüche geben.“
Allerdings, da ist sich Ebbers sicher, müsste sich dazu auch die Zusammensetzung des VRR-Parlamentes, die Verbandsversammlung ändern: „Dort dürften nicht Kommunalpolitiker sitzen, sondern Menschen mit einem Blick für regionale Fragen.“
Aber an ein solches Gesetz denken weder Landespolitiker noch die Verkehrsplaner der Städte.
Doch nicht nur die Strukturen sind ein Problem – der Nahverkehr in NRW ist auch chronisch unterfinanziert: Als im Zuge der Bahnreform 1993 der Bund und die Länder gemeinsam festlegten, welches Land wie viele Mittel pro Bürger vom Bund für den Regionalverkehr bekommen sollte, wurde eine bis heute anhaltende Benachteiligung NRWs festgeschrieben: Seitdem erhält NRW pro Bürger 30% weniger Bundesmittel als Hessen.
Die Landesregierungen hat das nicht wirklich gestört: Als Anfang des Jahrhunderts der Schlüssel neu verhandelt wurde, erinnert sich Ebbers, hatte NRW kein Interesse an einer Änderung des Schlüssels: „Das Land unter Clement spekulierte auf Bundesmittel für den Metrorapid.“
Auch unter Schwarz-Gelb änderte sich nichts zum Guten: „Wittke hatte kein Interesse am Personennahverkehr und wollte vor allem Geld für den Straßenbau vom Bund. Und gespart hat das Land auch beim Nahverkehr: Als der Bund die Höhe der Regionalmittel senkte, haben viele Länder das aus eigenen Mitteln ausgeglichen: NRW nicht.
.jpg)

.jpg)
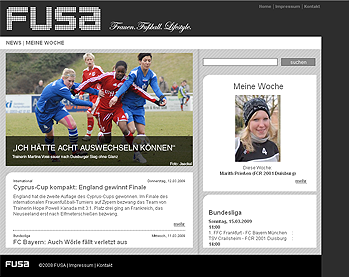 Da die Berichterstattung über den Frauenfussball in Deutschland immer noch schleppend verläuft, obwohl sich Fußball bei jungen Mädchen mittlerweile zur Trendsportart gemausert hat, ist seit kurzem mit
Da die Berichterstattung über den Frauenfussball in Deutschland immer noch schleppend verläuft, obwohl sich Fußball bei jungen Mädchen mittlerweile zur Trendsportart gemausert hat, ist seit kurzem mit 
.jpg)



 Foto:
Foto: 