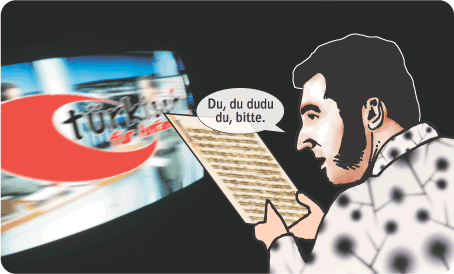Ende November wählt die Union im Revier einen neuen Vorsitzden. Norbert Lammert wird nach 22 Jahren nicht mehr kandidieren. Eine gute Gelegenheit für ein Abschiedsinterview.
Norbert Lammert. Foto: Bundestag
?: Sie treten nach 22 Jahren an der Spitze der CDU Ruhr im November nicht mehr als deren Vorsitzender an. Sind Sie mit Bilanz zufrieden?
Dr. Norbert Lammert: Im Großen und Ganzen ja, und wenn natürlich nicht alle Blütenträume gereift sind, vor allem nicht in der aus meiner Sicht gebotenen Zeit. Es entwickelt sich fast alles in die richtige Richtung, aber fast alles mit einer Verzögerung, die wir uns angesichts der Herausforderungen und des schärfer werdenden Wettbewerbs zwischen den Regionen nicht erlauben können. Ich hätte mir gewünscht, dass manches längst beschlossen wäre, was erst auf dem Weg ist.
?: Meinen Sie die Schaffung eines Ruhrbezirks, der ja innerhalb der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf auf dem Programm steht, aber auch dort nicht nur Freunde hat?
Lammert: Es geht dabei um die Bündelung der Zuständigkeiten zwischen den Kommunen und dem Land, keineswegs nur die Schaffung eines neuen Regierungsbezirks. Es geht dabei um die administrative Neustrukturierung des ganzen Landes. Das geht nur als Bestandteil einer großen Landestrukturreform – das ist Teil des Regierungsprogramms. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Landesregierung an diesem Ziel fest hält. Jürgen Rüttgers ist der erste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes, der die Unvermeidlichkeit der Änderung der administrativen Verfassung des Ruhrgebietes und Landes-Nordrhein Westfalen eingesehen und daraus konkrete operative Schlussfolgerungen gezogen hat. Auch wenn ich mir mehr Tempo wünschen würde: An diese Aufgabe hat sich, ob aus der CDU oder der SPD, keiner seiner Vorgänger herangewagt. Dass nicht alle Mitglieder der Koalition an dem Projekt mit gleicher Leidenschaft arbeiten, ändert nichts an meiner Einschätzung.
?: Sollte das Ruhrparlament künftig direkt gewählt werden?
Lammert: Nicht nur im Ruhrgebiet, auch im Rheinland und in Westfalen sollten die Regional-Parlamente direkt von den Bürgern gewählt werden. Allerdings nur dann, wenn Sie auch ernsthafte parlamentarische Kompetenzen haben.
?: Warum kandidieren Sie kein weiteres Mal um den Vorsitz? Ist Ihre Kraft zu Ende?
Lammert: Nein, ich habe das Amt des Vorsitzenden der CDU Ruhr seit über 20 Jahren ausgefüllt. Eine andere große Volkspartei hat in dieser Zeit zehn Bundesvorsitzende kommen und gehen sehen. Ich bin jetzt länger Vorsitzender der CDU Ruhrgebiet als Konrad Adenauer CDU-Chef war. Wir reden also über eine außergewöhnlich lange Zeitspanne. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, wann der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist. Nach meiner Wahl zum Bundestagspräsidenten habe ich mich noch einmal für zwei Jahre an der Spitze der CDU Ruhr verpflichtet, um Sorge dafür zu tragen, dass der Zug Verwaltungsstrukturreform aus Sicht des Ruhrgebiets auf die richtigen Gleise gehoben wurde und in die richtige Richtung fährt.
?: Nicht wenige, denen das Ruhrgebiet wichtig ist, hätten sich gewünscht, dass Sie noch einmal für zwei Jahre kandidieren, um sicher zu stellen, dass die Verwaltungsstrukturreform auch noch in der nächsten Legislaturperiode auf dem Aufgabenzettel der Landesregierung steht.
Lammert: Es ist zwar schmeichelhaft, entspricht aber nicht den Tatsachen, dass niemand sonst dieses Amt ausfüllen kann. Ich habe mich entschieden, jetzt den Schnitt zu machen, der ohnehin eines Tages fällig ist. Um alle meine Ziele für das Ruhrgebiet zu erreichen, würden ohnehin zwei Jahre nicht reichen – dafür brauchen wir einen langen Atem.
?: Hat es auch was mit Ihrem Amt als Bundestagspräsident zu tun?
Lammert: Natürlich. In den kommenden zwei Jahren werden wir in NRW alle Wahlen haben, die unsere Verfassung kennt. Als Bundestagspräsident muss ich mich in der Auseinandersetzung der Parteien zurückhalten – alles andere verträgt sich mit diesem Amt nicht. Ein Parteivorsitzender hat aber Wahlen als Speerspitze seiner Partei zu bestreiten und muss vor Ort ständig präsent sein. Das kann ich als Bundestagspräsident nicht gewährleisten. Es erfordert aber auch einen Vorsitzenden, der die Partei im Wahlkampf in Auseinandersetzungen führt, die zugespitzt werden müssen. Da sollte ein Parlamentspräsident, der ja einer gewissen Überparteilichkeit verpflichtet ist, sich zurückhalten.
?: Oliver Wittke gilt als ihr designierter Nachfolger…
Lammert: Es gehört zu den schönen Traditionen der CDU Ruhr, dass bei uns Vorsitzende nicht ernannt oder gesalbt, sondern gewählt werden. Auch mein Nachfolger wird gewählt. Ich habe zwar gewissen Vorstellungen, wer das sein sollte, warte aber voller Demut die Entscheidung des Parteitages ab.
?: Sollte sich der Parteitag für Oliver Wittke entscheiden, stellt sich die Frage: Ist er im Kabinett Rüttgers stark genug, die Interessen des Ruhrgebiets zu vertreten?
Lammert: Sollte es so kommen wie Sie und ich aus guten Gründen vermuten, wird die Stellung von Oliver Wittke im Kabinett dadurch gestärkt werden, dass er dann auch Vorsitzender der CDU Ruhr, des größten Bezirks in NRW, ist. Wittke wird im Landtagswahlkampf eine wichtige Rolle spielen und sich noch stärker als bisher für die Verwaltungsstrukturreform einsetzen können, die für das Ruhrgebiet eine Frage von existenzieller Bedeutung ist.
?: Im kommenden Jahr findet auch die Kommunalwahl statt. Wie schätzen Sie die Aussichten der Union ein?
Lammert: Gut.
?: Sie werden ja noch einmal für den Bundestag kandidieren.
Lammert: Ich wurde meinen Parteifreunden im Wahlkreis erneut nominiert und bin zuversichtlich, wieder in den Bundestag gewählt zu werden.
?: Stehen Sie wieder für das Amt des Bundestagspräsidenten zur Verfügung?
Lammert: Um dieses Amt bewirbt man sich nicht, dafür wird man vorgeschlagen – aber unabhängig von meinen Wünschen hängt diese Frage natürlich auch vom Ergebnis der Bundestagswahl ab.
?: Das Amt des Bundestagspräsidenten füllen Sie aber sehr gerne aus.
Lammert: Das ist unbestritten – und viele sagen freundlicherweise: nicht nur gerne, sondern auch gut.



.jpg)