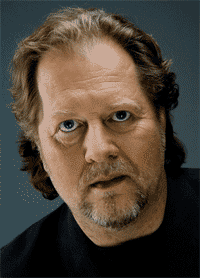
Dieter Gorny ist als Direktor der Kulturhauptstadt RUHR.2010 für den Bereich Kreativwirtschaft verantwortlich. Der Gründer des Musikkanals VIVA erklärt im Interview, warum das Dortmunder U keine Museum werden darf, es im Ruhrgebiet genung Konzerthäuser gibt und welche Chancen die legendäre Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet hat
Kreativquartiere in Dinslaken, Dorsten und Unna – Ist das nicht wieder die typische Kirchturmpolitik, die wir im Ruhrgtebiet seit Jahrzehnten kennen und bei der es nur darum geht, dass jeder etwas vom Kuchen abbekommt? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich auf die drei Quartiere im Revier zu konzentrieren, die wirklich die Chance haben, sich weiter zu entwickeln: Essen-Rüttenscheid, das ViktoriaQuartier in Bochum am Bermudadreieck und das Klinik- und Kreuzviertel in Dortmund in der Nähe des Dortmunder U?
Ja und nein. Erstens: Dinslaken ist eine Ausnahme. Dort geht es darum, über das Vehikel Kreativquartier eine Diskussion zwischen den verschiedenen Interessengruppen, den Planern, der Politik und der Wirtschaft, über die Entwicklung eines urbanen Quartiers anzustoßen. Da geht es auch um das Selbstverständnis als Stadt, und diese Diskussion hat in Dinslaken viel bewegt. Unna wird kein Kreativquartier im herkömmlichen Sinn, sondern eine Bildungs- und Weiterbildungsstätte. Der Ort, das alte Durchgangslager in Massen, ist so skurril, dass man damit etwas machen muss. Dort kann man kontemplativ über Zukunft nachdenken. Wir werden dort Kongresse veranstalten, aber planen keine Ansiedlung von Unternehmen.
Ursprünglich sollten sich dort aber Künstler ansiedeln.
Die Idee ist leider nicht realisierbar. Wir mussten einsehen, dass so etwas an diesem Standort entweder gar nicht oder nur mit sehr hohen Subventionen möglich gewesen wäre. Bei den von Ihnen genannten Quartieren sieht das alles anders aus: Sie haben so zentrale Lagen, dass man aus ihnen etwas machen kann. Aber wir sind immer noch in der Vorbereitungsphase. Uns geht es jetzt vor allem darum, Impulse zu setzen, eine Diskussion zu beginnen. Die Kreativquartiere brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Uns ist es gelungen, das Bewusstsein zu schaffen, dass die Entwicklung solcher Quartiere eine Chance für die Städte und das Ruhrgebiet ist. In einer zweiten oder dritten Stufe werden dann auch wirtschaftliche Erfolge sichtbar. Wir werden Cluster haben, die sich gut entwickeln. Wir werden aber auch Quartiere haben, die scheitern werden. Wir sind in einen offenen Prozess eingetreten, aber wer glaubt, man kann einfach einen Standort als Kreativquartier ausrufen und die Sache läuft, irrt.
Haben die Städte wirklich verstanden, worum es geht? Das Dortmunder Quartier rund um das U gehört sicherlich zu den Orten mit den besten Chancen, ein funktionierendes Kreativquartier zu werden. Aber Kreativwirtschaft ist dort mittlerweile nur noch eine Option. Die Stadt hat die Zuschüsse des Landes abgegriffen und scheint sie nun für die Umsetzung von Langemeyers alten Museumsplänen zu nutzen. Hat sich der ehemalige Dortmunder OB doch noch durchgesetzt?
Wir können am Dortmunder U das ganze Wohl und Wehe einer Strukturdebatte festmachen. Das U ist ein ausnehmend exemplarischer Ort, der einfach auch spannend liegt. Er ist durch die Nähe zur Rheinischen Straße, dem Klinik- und dem Kreuzviertel ein hoch attraktiver Standort für Kreativ-Unternehmen. Dass die Stadt sich entschlossen hat, das neue FZW in der Nachbarschaft anzusiedeln, macht dieses Quartier noch stärker. Schaue ich mir jetzt den Standort an, seine Potenziale, sein Umfeld, dann passt da kein normales Museum hin. Siedelt man es trotzdem dort an, wird es ein Flop. So sehr die Stadt auch das U für sich reklamiert, es ist ein Symbol für die Idee der Kreativquartiere und wirkt weit über Dortmund hinaus. Werden die Chancen, die das U hat, vertan, wäre das ein Rückschlag für alle, die sich für das U eingesetzt haben. Die Landesregierung hat die Millionen, die sie für das U bereitgestellt hat, aus guten Gründen nicht für den Bau eines Museums gegeben und sollte sehr genau darauf achten, dass ihr Geld wie ursprünglich vorgesehen ausgegeben wird. Es ging hier um die Entwicklung urbaner Räume – und nicht die Musealisierung dieses Gebäudes.
Alle Projekte rund um das Thema Kreativwirtschaft haben eines gemeinsam: Sie werden 2010 nicht fertig sein – weder das U noch das Konzerthaus in Bochum…
Einspruch. Das Investment von Leo Bauer und Frank Goosen, das neue Kleinkunst-Theater auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände neben dem Bermudadreieck, wird fertig und ich halte es als Impulsgeber für wesentlich wichtiger als das Konzerthaus. Das Bermudadreieck und sein Umfeld sind allein durch das Schauspielhaus und die Bestrebungen der Uni, dort ihre Präsenz zu steigern, immer wortlastig gewesen. Ein Kleinkunst-Theater ergänzt diese Entwicklung. Das Konzerthaus wäre ein Solitär. Es schadet nicht, aber es wäre kein prägender Faktor für die weitere Entwicklung des ViktoriaQuartiers. Das haben wir immer deutlich gemacht.
Macht es überhaupt Sinn, zwischen Dortmund und Essen noch ein weiteres Konzerthaus zu bauen? Setzt die Stadt Bochum nicht auf das falsche Pferd?
Wenn Sie sich die Struktur des Ruhrgebiets ansehen, haben wir es immer noch mit unabhängigen Städten zu tun. Und aus einer lokalen Sichtweise mag der Bau des Konzerthauses in Bochum Sinn machen. Betrachtet man sich das Ruhrgebiet als Ganzes, muss man eine solche Planung, auch im Hinblick auf Auslastungszahlen und Zuschauerwanderungen, kritisch sehen. Und man muss sich die Frage stellen, ob Investments in diese Art von Kultur mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung überhaupt noch Sinn machen. Ob ein Konzerthaus die Kreativen halten kann, die wir zukünftig brauchen und die Region für jungen Kreative attraktiv zu machen, wage ich zu bezweifeln.
Was muss getan werden, um diese Klientel im Ruhrgebiet zu halten?
Wir müssen erkennen, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich kulturell anders ausgerichtet hat, als es die Formen von Kultur vorgeben, die mit Subventionen am Leben erhalten werden. Es sind doch die Menschen, die in den Off-Theatern sind, die eigene Bands gründen, Galerien eröffnen oder auf eine andere Art und Weise selbst kreativ tätig werden, die eine Region lebendig werden lassen. Diese Leute muss man halten, man muss sie unterstützen und ihnen die Freiräume geben, die sie benötigen. Das ist allerdings immer noch das Gegenteil von dem, was man unter normaler Kulturpolitik versteht.
Kann die Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet jemals die gleiche Bedeutung bekommen wie in Köln, Hamburg oder Berlin?
Die Kreativwirtschaft wird, wenn man sie in den vorhandenen urbanen Strukturen verclustert, dort durchaus eine der vielen Alternativen zur alten Wirtschaftsstruktur sein. Aber auch dort, wo sie nicht viele neue Arbeitsplätze schafft, sorgt sie für die Farbigkeit und Attraktivität, die das Ruhrgebiet braucht, um in Zukunft im Wettbewerb mit anderen Metropolen bestehen zu können. Auch Menschen, die von Beruf Ingenieur, Steuerberater oder Manager sind, legen Wert auf ein spannendes und attraktives Umfeld. Nur Städte, in denen es Kreative gibt, in denen sie die Stimmung prägen, werden auf diese Klientel anziehend wirken. Es würde uns gut tun, wenn wir für die Kreativen ein paar alte Industrie-Gebäude zur Verfügung stellen würden. Da könnten spannende Sachen entstehen, die niemand voraussagen kann und die für die Attraktivität des Reviers wichtig wären. Solche Projekte, die kreative Freiräume geben, brauchen wir viel mehr als bisher. Das ist eine große Chance für das Ruhrgebiet, denn andere Metropolen wie Berlin werden allmählich satt. Wir können durch Freiräume und Offenheit Menschen begeistern, ins Ruhrgebiet zu kommen.
Was Kreative allerdings auch brauchen, ist Geld. Viele der großen Projekte der Kulturhaupstadt gingen an Agenturen aus Hamburg oder Berlin. Die heimische Szene ging weitgehend leer aus.
Auch die RUHR.2010 GmbH muss sich an das Vergaberecht halten…
Glauben Sie, dass bei einem vergleichbaren Ereignis in Berlin Düsseldorfer Agenturen zum Zuge gekommen wären oder dass Hamburg bei so einer Gelegenheit auf Werber aus Frankfurt gesetzt hätte?
Nein, und bei den Vergaben ist zwar formell alles richtig, inhaltlich aber vielleicht einiges falsch gelaufen. Das muss sich künftig ändern. Es sollte festgeschrieben werden, dass auch Unternehmen aus der Region an Projekten wie der Kulturhauptstadt beteiligt werden müssen. Solche Chancen zur Profilierung müssen stärker genutzt werden.
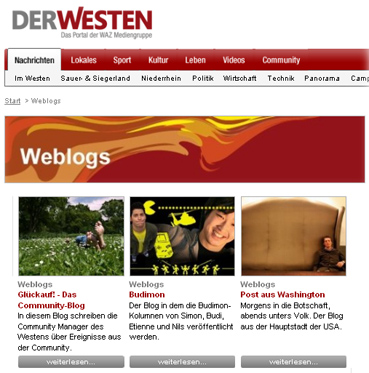




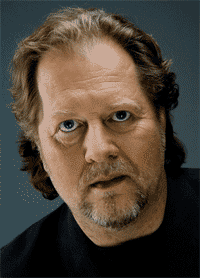
 Das Musiktheater im Revier sucht seinen Weg in die digitale Welt und es sucht auch den Weg zu jungen Zuschauern. Mit dem Experiment „
Das Musiktheater im Revier sucht seinen Weg in die digitale Welt und es sucht auch den Weg zu jungen Zuschauern. Mit dem Experiment „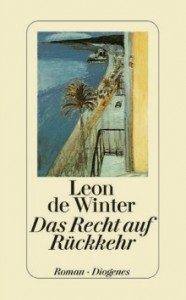 Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter zählt zu den erfolgreichsten Gegenwartsschriftstellern in Europa. Auch als Essayist meldet sich der Sohn niederländischer Juden regelmäßig zu Wort: Den einen gilt er als Verteidiger der Aufklärung, den anderen als ein islamophober Hysteriker, der mit seinen Kommentaren leichtfertig antimuslimische Ängste schürt. Im Interview spricht de Winter über seinen neuen Roman, Israels düstere Perspektiven und die Gefahr durch den Iran.
Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter zählt zu den erfolgreichsten Gegenwartsschriftstellern in Europa. Auch als Essayist meldet sich der Sohn niederländischer Juden regelmäßig zu Wort: Den einen gilt er als Verteidiger der Aufklärung, den anderen als ein islamophober Hysteriker, der mit seinen Kommentaren leichtfertig antimuslimische Ängste schürt. Im Interview spricht de Winter über seinen neuen Roman, Israels düstere Perspektiven und die Gefahr durch den Iran.

