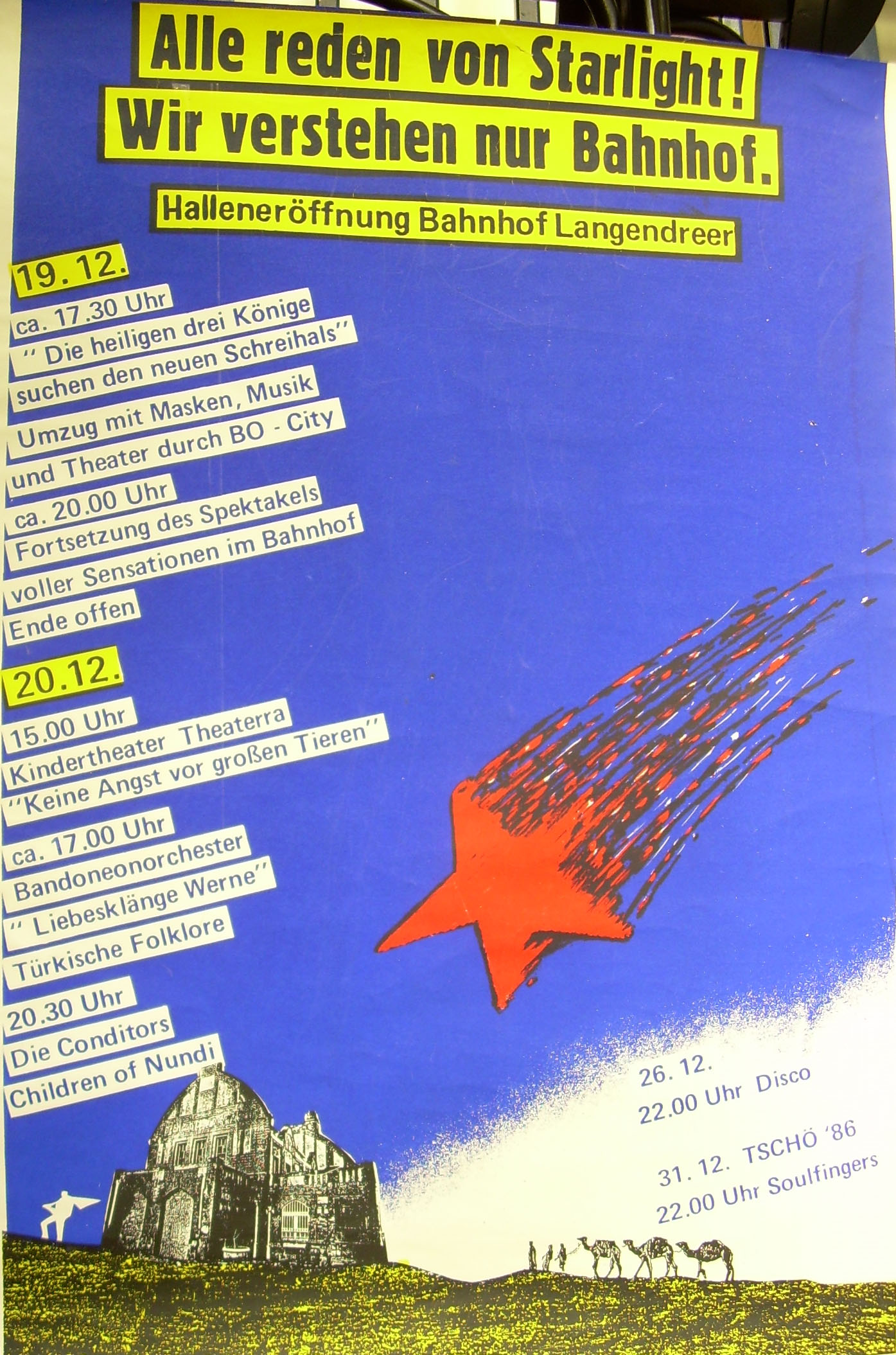In dieser Reihe wurden und werden (zuletzt hier) unterschiedliche Ansätze und Historien von Soziokultur, (Sub-)Kulturermächtigung und durchaus auch Pop orientierter Jugendarbeit vorgestellt. Beteiligt sind immer politisch, wirtschaftlich, gesellig, lokalpatriotisch und/oder individualistisch geprägte Menschen, teils schon in Gruppen organisiert, die irgendwann Bündnisse mit der Kommune schließen. Eine ganz eigene Herangehensweise zeigt sich im Gespräch mit Holger Bergmann, dem Künstlerischen Leiter des Ringlokschuppens.
In dieser Reihe wurden und werden (zuletzt hier) unterschiedliche Ansätze und Historien von Soziokultur, (Sub-)Kulturermächtigung und durchaus auch Pop orientierter Jugendarbeit vorgestellt. Beteiligt sind immer politisch, wirtschaftlich, gesellig, lokalpatriotisch und/oder individualistisch geprägte Menschen, teils schon in Gruppen organisiert, die irgendwann Bündnisse mit der Kommune schließen. Eine ganz eigene Herangehensweise zeigt sich im Gespräch mit Holger Bergmann, dem Künstlerischen Leiter des Ringlokschuppens.
Jens Kobler ?: Zunächst, wie in dieser Reihe üblich, bitte eine kurze Vorstellung der Institution Ringlokschuppen und auch der eigenen Rolle des Holger Bergmann in diesem Rahmen.
Holger Bergmann !: Nun, der Ringlokschuppen ist einer der jüngsten freien Kulturorte des Ruhrgebietes. Der Start war 1995, das war nach einer langen Phase des Vakuums für freie Räume und Soziokultur in Mülheim. Seit den Achtziger Jahren gab es einige Versuche etwas zu etablieren, aber meist mit dem Erfolg der Nicht-Realisierung, gerade anbetracht der hier agierenden sehr starken Sozialdemokratie genau in diesen Jahren. Exakt in der Zeit des schwarz-grünen Bündnisses, das ja nur ein halbes Jahr getragen hat, wurde der Ringlokschuppen realisiert, dann aber auch mit der Zustimmung der SPD. Das war politisch eine ungewöhnliche Konstruktion.
Der Weg dahin gestaltete sich für mich persönlich u.a. dadurch, dass ich freie Theaterprojekte in der Stadt gemacht habe und wir ein Forum mit verschiedenen Leuten aus der Kunst- und Kulturszene gegründet hatten, die auch eher eine Affinität zur darstellenden Kunst hatten. In diesem Gebäude hier wurde wiederum von Seiten der Stadt eine Bürgerbegegnungsstätte betrieben, nachdem zur Landesgartenschau umgebaut worden war. Als dann auch dort nach 1992 ein inhaltliches Vakuum zu verzeichnen war, wurden Vermietungsverträge geschlossen, u.a. mit Agierenden aus diesem Forum. 1995 sagte man sich dann "Nicht nur den Kuchen, sondern die ganze Bäckerei" und mietete das ganze Haus. Zunächst wurde also Programm gemacht, und dann erfolgte die Gründung des Vereins, auf dass die "Übernahme" möglich wurde.
?: Also gab es nie eine Situation wie "Diese Autonomen dürfen froh sein, da überhaupt etwas machen zu dürfen", sondern es gab von vornherein eine günstige Ausgangslage?
!: Es ging mehr darum, die aktuellen gesellschaftlichen Regularien zu suchen, damit wir unseren Gestaltungswillen verwirklichen können. Denn es war ja auch ganz klar nach 1989.
?: Das deckt sich sehr gut mit einer meiner Generalthesen zu den Unterschieden zwischen all den soziokulturellen Zentren und ihren Verhältnissen zur jeweiligen Stadt. Dass da nämlich genau ein Bruch zu verzeichnen ist, Ende der Achtziger. Mittlerweile wird ja sogar eher im großen Stil versucht, ganze Areale zu recht kommerziell oder kreativwirtschaftlich ausgerichteten Zentren fast eher zu erklären, und von den Ansätzen der späten Siebziger, frühen Achtziger ist in späteren Modellen von Soziokultur und Kreativzentren nichts mehr zu bemerken.
!: Nun, wir hier sind nicht "gesetzt" von oben. Es gab da keine Strategie die uns sagte "Wir bauen jetzt hier diesen Ringlokschuppen um", sondern im Gegenteil ging es um ein Bürgerbegegnungszentrum, in dem vom Medienhaus über Hühnerzuchtausstellungen alles Mögliche stattfinden sollte, und in dem Kultur nicht besonders vorkam. Aber das, ebenso wie das von Dir gerade Beschriebene, sind ja durchaus auch alles Verzweiflungsstrategien in einer Region, die immer nur durch das Interesse von Industrie bestimmt war, hier Humankapital anzusiedeln und nur minimal zu versorgen. – Und das hat Anfang des letzten Jahrhunderts sogar in Teilen besser funktioniert, wenn man sich Strukturen wie die Margarethenhöhe in Essen mal anschaut. – Dieser Aufbruch hat allerdings immer unterschlagen dass es eigene Potentiale gibt und hat so die Verknüpfung nicht hinbekommen. An diesem Punkt sieht man auf Zollverein zum Beispiel einerseits gewachsene Strukturen wie PACT!, mit gewachsenen regionalen wie internationalen Strukturen, andererseits aber auch Aufbruchbehauptungen, die bisher nur schwer realisiert werden konnten.
?: Es ist ja auch durchaus Markenzeichen des Ringlokschuppens, sich eben nicht nur als Veranstaltungshalle zu begreifen und sich von Agenturen und Institutionen vorschreiben zu lassen, wie das Programm zu gestalten sei.
!: Na klar! Rückblickend auf die Neunziger ist es aber auch durchaus okay zu respektieren, wenn sich zu dieser Zeit Leute in Strukturen begeben haben, wo sie arbeiten können und wo sie dafür auch bezahlt werden. Was allerdings nicht richtig ist, ist sich damit zu begnügen. Bei Stuckrad-Barre kann man das schön nachlesen wie es ist, in einem Kulturzentrum aufzutreten, wo einfach immer ein Plakat über das nächste geklebt wird. Das hat natürlich ein Publikum, und das ist auch richtig. Aber es kann ja nicht kulturelle Aufgabe der Häuser sein, nur diesen Weg zu erfüllen. Wir waren hier in den Neunzigern eben in der glücklichen Situation, dass es halt keine freie Kultur gab, die sich mannigfaltig und tausendfach artikulieren wollte – sondern es ging darum das erst einmal herzustellen.
Und man kann ja durchaus mal fragen: Warum geht denn jetzt inzwischen die Oper in diese Fabrikhallen? Was also ist der Vorteil, den diese freie Kultur damals entwickelt hat? Ich denke, es war auch das Fehlen des Genre-Gedankens. Es ging nie um das reine Theater, die reine Musik, das Architekturprojekt, etc. Sondern man holte sich immer verschiedene Kräfte zusammen. Es war auch die Suche nach dem gesellschaftlichen Kontext, nach der Reibungsfläche für die Kultur. Wir haben uns gefragt: Wie können wir das leisten? Wie stellen wir das unter den aktuellen Verhältnissen her? Und ich habe das auch einmal ausgetragen, als ich im Bundesvorstand der soziokulturellen Zentren war. Da war meine Haltung etwa diese: "Ihr könnt doch diese Zentren nicht dem Gestaltungswillen von Geschäftsführern überlassen!" Denn in den Achtzigern ging es plötzlich viel um die ökonomische Struktur der Zentren, aber wenig um Inhalte. Mitte der Achtziger waren bei den meisten die Programmdiskussionen weit passé. Daher gibt es auch hier z.B. keine Intendanz oder nur einen Booker, sondern eine künstlerische Leitung.
 ?: Hier wird ja auch nicht nur einfach an Disco-Veranstalter oder einzelne Gruppen delegiert. Wie organisiert sich der Ringlokschuppen?
?: Hier wird ja auch nicht nur einfach an Disco-Veranstalter oder einzelne Gruppen delegiert. Wie organisiert sich der Ringlokschuppen?
!: Das geschieht schon stark als Team, und das ist keine Floskel. Aber es gibt natürlich Entscheidungsstrukturen, und da wo aus unterschiedlichen Interessen heraus etwas stockt, da wird das dann aufgelöst. Streitigkeiten und Differenzen werden in soziokulturellen Zentren oft über Jahre nicht ausgeräumt, aufgrund festgefahrener Strukturen. Wir haben hier eine Doppelspitze, mit Peter Krause als Kaufmännischer Geschäftsführer und mir als Künstlerischem Leiter. Und ich glaube dass das richtig ist, dass wir zwei uns dann manchmal die Köpfe einschlagen und nicht das ganze Haus. Es ist aber auch Voraussetzung, dass sich jeder wiederfindet und einbringt.
?: Das hiesige inhaltliche und strukturelle Konzept erklärt sich vielleicht am besten über den derzeitigen "Aufstand gegen die Wirklichkeit".
!: Wir konnten darunter einige Projekte zusammen fassen wie die Ruhrtriologie von René Pollesch, unser Stadtteilprojekt "Eichbaumoper" oder – ganz aktuell – "Altneuatlantis" von kainkollektiv. Und so ist manchmal hier auch eine Woche lang nichts los, weil wir einen anderen Ort bespielen oder den Ort herrichten oder anders nutzen müssen. Im Rahmen der RuhrTriennale oder der Kulturhauptstadt realisieren wir auch viele Projekte in anderen Städten, weil für uns diese Auflösung von Stadtgrenzen eh schon lange gegeben ist.
?: Das sind natürlich nicht nur selbst getragene Projekte. Dieser Spagat funktioniert also: Nicht mal eine kommerzielle Disko machen zu müssen, hier auch einmal geschlossen haben können, und inhaltlich keine Abstriche machen zu müssen bei diesen Großprojekten!??
!: Ökonomisch betrachtet bringt so ein Diskobetrieb gar nicht so viel wie es oft heißt. Wir bekommen derzeit einen kommunalen Zuschuss von knapp 500.000 Euro, wovon 300.000 direkt als Mietkosten wieder zurück gehen. Und so haben wir beschlossen, uns keinen zu großen Apparat zu halten. Die Gastronomie ist vermietet, und auch das ist keineswegs ein Nachteil. Insgesamt sind wir hier 13 Leute auf 18 Stellen und haben etwa einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro zu machen. Unsere Reihe "Kulturgut" in der Stadthalle ist ausgegliedert und genau der Teil des Programms, wo wir 40, 50 Veranstaltungen pro Jahr machen, wo denn auch Namen wie Esther Ofarim, Herbert Knebel oder Heinz-Rudolf Kunze auftauchen. Diesen Markt bedienen wir halt in der Stadthalle. Und den Part für Jugendliche und Stadtteilarbeit auch übernimmt in Mülheim ja das AZ. Insofern und anbetracht der Tatsache, dass dieses Haus hier das Stadtjubiläum im letzten Jahr kuratiert hat, zeigt sich schon, dass wir bestimmte öffentliche Kulturaufgaben mit übernehmen. Und das ist durchaus eine Position der Anfangsjahre: Besser auch einmal Aufgaben an gemeinnützige Vereine übertragen als neue städtische Strukturen zu schaffen. In dieser Zeit ohne Kultusministerium und wenn der Verzicht auf Kulturdezernenten ein offenes Thema ist, muss bei den zukünftigen Herausforderungen schon gesehen werden, wer die Kulturarbeit dann überhaupt leisten kann.
?: Was ja nicht bedeutet, die Politik und die Kommune aus der Verantwortung zu entlassen…
!: Deshalb haben wir ja immer temporäre Aufgaben übernommen, aber es geht nicht um das Ersetzen von städtischen Strukturen, weder im kulturellen, noch im sozialen Bereich. Der Ringlokschuppen selbst hat sich ja immer mehr zu einem Ort verschiedener Künste entwickelt und es gibt sonst keinen Ort im Ruhrgebiet, der solch einen Fokus auf diese Bereiche bieten kann. Diesen Charakter wollen wir 2010 als temporäres "Theaterhaus Ruhr" stärken, mittels Kooperationen mit z.B. den Stadttheatern im Ruhrgebiet, dem FFT in Düsseldorf oder der Volksbühne Berlin. Mit der zusätzlichen Förderung von je 300.000 Euro, die das Land für zwei Theaterhäuser in Köln und Essen hingeblättert hat, könnten wir hier in unserer Netzwerkstruktur einiges anfangen, das in anderen Haushalten eher verschwindet. Wir sehen unsere Entwicklung im Vergleich als sehr progressiv und werden nicht zurückgehen zu einem Haus, das einfach Kabarett- und Konzertveranstaltungen abliefert. Die Frage an die Landesregierung ist eher, ob solch ein Ort nicht weiter entwickelt werden sollte. Und darum werden wir im nächsten Jahr verstärkt kämpfen.
?: Besten Dank für das aufschlussreiche Gespräch!


 ?: Wie organisiert man so eine Zusammenarbeit?
?: Wie organisiert man so eine Zusammenarbeit?  ?: Bei Köln in Teilen und vor allem in Berlin hat man ja immer ganz subjektiv das Gefühl, dass da selbst der Großneffe von Willy Millowitsch so ein bisschen auch von dem Gefühl getragen wird: Hey, hier ist eine Stadt mit einer weltweit beachteten Popkulturszene. Und das ist hier ja erst bedingt so. Da hat dann Katernberg mal einen großen Tag wenn Freakatronic im Shanghai spielt, oder Altenessen wenn Kreator Topact in Werden ist…
?: Bei Köln in Teilen und vor allem in Berlin hat man ja immer ganz subjektiv das Gefühl, dass da selbst der Großneffe von Willy Millowitsch so ein bisschen auch von dem Gefühl getragen wird: Hey, hier ist eine Stadt mit einer weltweit beachteten Popkulturszene. Und das ist hier ja erst bedingt so. Da hat dann Katernberg mal einen großen Tag wenn Freakatronic im Shanghai spielt, oder Altenessen wenn Kreator Topact in Werden ist…