
Im Jahr 2002 startete die erste Ruhrtriennale. Doch die Geschichte des Festivals beginnt deutlich früher.
Hätte Karl Ganser seinen Job richtig gemacht, es gäbe wahrscheinlich keine Ruhrtriennale. Ganser leitete von 1989 bis 1999 die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA), ein Mammutprojekt, das von dem damaligen NRW-Stadtentwicklungsminister Christoph Zöpel (SPD) ausging. Mit 1,5 Milliarden Euro öffentlicher Gelder und einer weiteren Milliarde an privaten Investitionen sollten die städtebaulichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Impulse für den wirtschaftlichen Wandel im nördlichen Ruhrgebiet gesetzt werden. Die Landesregierung unter Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) wollte mit einem großen Wurf vor allem das nördliche Ruhrgebiet stabilisieren. In den 80er Jahren hatte sich die wirtschaftliche Situation im Ruhrgebiet massiv verschlechtert, im Norden des Reviers, der Emscherzone, drohte sogar der Verfall. Während es in den 60er und 70er Jahren in den Städten im Zentrum des Ruhrgebiets gelang, durch Universitätsneugründungen und Großansiedlungen wie Opel und Siemens neue Perspektiven für eine Zeit nach dem Ende des Bergbaus zu schaffen, war das nördliche Ruhrgebiet lange vernachlässigt worden. Zwar konnten auch hier einige Firmen wie Siemens und Rockwool angesiedelt werden, doch der Norden war vom immer schneller dahinsiechenden Bergbau abhängig geblieben. Die Arbeitslosigkeit stieg, die Städte wurden immer unattraktiver und schrumpften, die Umweltbelastungen waren hoch, der Nahverkehr miserabel ausgebaut – was sich bis heute übrigens nicht geändert hat.
Im Zusammenhang mit der IBA wurden zahlreichen Wohnungen im nördlichen Ruhrgebiet renoviert: Die Zeit der Kohleöfen ging endgültig zu Ende, vielen Mietern standen zum ersten Mal Badezimmer und Duschen zur Verfügung. Fassaden wurden gestrichen und erneuert, das schmuddelige Dunkelgrau bestimmte nicht mehr das Bild der Städte.
Ganser und der IBA gelang es auch, mit einigen wenigen Neubauprojekten, aber vor allem durch seinen Einsatz für den Erhalt alter Zechen- und Stahlwerksgebäude, ein Bewusstsein für Architektur zu schaffen. Die wirtschaftlich unnütz gewordenen Hallen wurden ebenso wie Zechensiedlungen zu Zeugnissen der Industriearchitektur geadelt und so fest als wertvolle Architektur im Bewusstsein der Politiker und Bürger verankert. Ganser verstärkte damit allerdings vor allem eine Entwicklung, die schon in den 70er Jahren begonnen hatte: Damals wurden im Ruhrgebiet zahlreiche Zechensiedlungen vor dem Abriss gerettet, weil ihre Bewohner sie besetzten. Jugendliche taten es ihnen gleich und erstritten die Nutzung alter Industriegebäude als Kulturzentren.
Das größte und erfolgreichste Projekt, das im Zusammenhang mit der IBA angestoßen, aber von der Emschergenossenschaft umgesetzt wurde, wird übrigens erst 2020 beendet sein: Der Umbau der Emscher und ihrer Nebengewässer von einem Netz stinkender Kloaken zu einem naturnahen Flusssystem. Die Lebensverhältnisse von hunderttausenden Menschen haben sich dadurch verbessert.
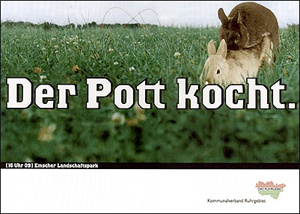 Als die IBA zehn Jahre später 1999 mit großen Feierlichkeiten und einer spektakulären Werbekampagne mit dem Slogan „Der Pott kocht“ zu Ende ging, war klar, dass wichtige Teilaufgaben der Bauausstellung nicht erfüllt wurden: Ganser machte am Ende keinen Hehl daraus, dass ihn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht großartig interessiert hatte – sein Schwerpunkt lag, wie er selbst sagte, auf „guter Architektur“.
Als die IBA zehn Jahre später 1999 mit großen Feierlichkeiten und einer spektakulären Werbekampagne mit dem Slogan „Der Pott kocht“ zu Ende ging, war klar, dass wichtige Teilaufgaben der Bauausstellung nicht erfüllt wurden: Ganser machte am Ende keinen Hehl daraus, dass ihn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht großartig interessiert hatte – sein Schwerpunkt lag, wie er selbst sagte, auf „guter Architektur“.
Das führte zu der Frage, was man nun mit den ganzen erhaltenen Industriegebäuden künftig anfangen sollte. Wirtschaftliche Nutzungskonzepte gab es nicht. Eine Idee, die Hallen günstig Gründern zur Verfügung zu stellen oder zu Lofts umzubauen, konnte sich nicht durchsetzen. Als Burkhard Drescher, damals Vorstand der RAG-Immobilien AG, Anfang des Jahrhunderts vorschlug, die im Besitz der RAG befindlichen alten Industriebauten für einen Euro an jeden zu verkaufen, der irgendein tragfähiges Nutzungskonzept vorweisen konnte, wurde er innerhalb von 24 Stunden von seinen Vorstandskollegen gezwungen, die Idee zu begraben. So pikant war sie, dass die Pressestelle der RAG-Immobilien Journalisten, die noch nicht über Dreschers Idee geschrieben hatten, bat, sie einfach zu vergessen und kein Wort darüber zu veröffentlichen.
Allerdings hielt sich der Bedarf an Gewerbeflächen damals auch in Grenzen. In Teilen des Ruhrgebiets lag die Arbeitslosigkeit in jener Zeit über 20 Prozent. Wirtschaftswachstum gab es in ganz Deutschland kaum, das Ruhrgebiet schrumpfte. Die Unternehmen hätten nicht Schlange gestanden, um die erhaltenen Immobilien kommerziell zu nutzen und die dringend benötigten Jobs zu schaffen.
Was blieb, war die Idee, einen großen Teil der Hallen für Kulturveranstaltungen zu nutzen.
Nur gab es schon damals keinen Mangel an Veranstaltungsgebäuden. Schon lange vor der IBA wurden Gebäude wie die „Zeche Carl“ in Essen, die „Zeche Bochum“, „Schacht8“ in Marl, das „Druckluft“ und die „Turbinenhalle“ in Oberhausen oder die ehemalige Kohlenwäsche in Hamm als Veranstaltungshallen genutzt. Dazu kamen zahlreiche weitere Veranstaltungsimmobilien wie die „Westfalenhallen“ in Dortmund und die „Grugahalle“ in Essen. Es gab zudem ein dichtes Netz an Schauspielhäusern und mehrere Städte hatten damals neue Konzerthäuser entweder gerade fertig gestellt oder in Planung.
Der Bedarf an den neuen Flächen war nicht da – oder zumindest kein Bedarf in der Größenordnung, die nun zur Verfügung stand: Jahrhunderthalle Bochum, Maschinenhalle Gladbeck-Zweckel, Salzlager Zollverein und Zechenwerkstatt Lohberg in Dinslaken, um nur die größten Hallen zu nennen.
Es musste also eine Idee für eine Nutzung dieser Hallen gefunden werden – und diese Idee war die Ruhrtriennale. Sie sollte Leben in die Hallen bringen, und sei es, wie in Gladbeck und Dinslaken, nur für wenige Tage im Jahr.
Dazu passte, dass das Ruhrgebiet an seiner Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2010 arbeitete. Zwar lag die letztendliche Entscheidung damals noch in weiter Ferne – sie wurde erst 2006 gefällt, aber erst einmal musste sich das Ruhrgebiet in NRW und Deutschland durchsetzen. Kultur wurde zu einem großen Thema. Wie groß war der in seinem Umfang und in seiner Qualität bis heute einzigartige vom Kommunalverband Ruhr 2003 herausgegebene Band „Kultur Kontrovers“, der auf 800 Seiten die regionale Kulturdebatte abbildete.
Ein großes Festival, eben die Ruhrtriennale, würde gleich mehrere Probleme lösen: Es würde die Frage der Nutzung der alten Industriehallen beantworten und der Bewerbung für die Kulturhauptstadt guttun. Zugleich konnte sich das Land als Kulturveranstalter profilieren und auch der damalige Kulturminister würde profitieren: Michael Vesper (Grüne), bis heute Vorstand im Förderverein des Festivals, stand seit Beginn der rot-grünen Koalition im Land NRW 1995 im Schatten seiner Ministerkollegin Bärbel Höhn. Die Ruhrtriennale war, wie die Kulturhauptstadtbewerbung – Vesper war allerdings ein Anhänger Kölns – auch das Projekt, mit dem er eine Aufgabe hatte, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Vesper war fähig und ambitioniert und litt darunter, dass dies kaum jemand mitbekam.
Die Ruhrtriennale war anfangs umstritten: Das Kultursekretariat Wuppertal, viele freie Kulturinitiativen, aber auch Schauspielhäuser der Region wollten die Millionen, die das Festival kostete, in den Bestand investiert sehen. Sie waren gegen das Festival.
Doch das Land und Minister Vesper setzten sich durch. Peter Landmann, der erste Geschäftsführer der Ruhrtriennale, erklärte in „Kultur Kontrovers“, warum das Land das Festival wollte: „Die Landesregierung will Nordrhein-Westfalen durch ein eigenes, unmittelbares Engagement als Kulturland stärker profilieren. Sie hat bewusst dieses neue Projekt nicht in der Landeshauptstadt Düsseldorf oder im Schatten des berühmten Doms am Rhein, sondern im strukturschwachen Industriegebiet an Ruhr und Emscher angesiedelt.“
Landmann betonte auch, die Ruhrtriennale solle viele „Elemente der Innovation, des Experiments, der Erkundung von Neuland“ enthalten. Die Politik hatte also zu keinem Zeitpunkt Angst vor „Radikalität“, wie es Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach seiner diesjährigen Absage vorgeworfen wurde. Radikalität auf der Bühne ist gerne gesehen. Politiker und das bürgerliche Publikum fürchten sie so wenig wie Jugendliche die Gruselpuppen in der Geisterbahn. Ein Arbeiterchor, der die Enteignung der Industrie fordern würde, kann sicher sein, freundlich belächelt zu werden. Bei Antisemitismus sieht das allerdings anders aus, er ist nicht bloß radikal, er ist eliminatorisch, zielt auf die Vernichtung der Juden, und das kann kein demokratischer Politiker ignorieren.
Die Ruhrtriennale war der Versuch, aus dem Mangel an Ideen zur Nutzung alter Industriegebäude das Beste zu machen: Ein Festival, mit dem sich das Ruhrgebiet und das Land Nordrhein-Westfalen profilieren sollten.
Genau für dieses Ziel, die Standortprofilierung, geben das Land, der Regionalverband Ruhr und die anderen Förderer das Geld der Steuerzahler aus. Die Ruhrtriennale unterscheidet sich damit sicher nicht von anderen Festivals. Es geht nicht in erster Linie um Kunst, sondern um die Nutzung von Kunst als Standortfaktor. Dass dies nicht so offen gesagt wird, gehört zum Spiel: Das Land und der RVR tun so, als ob sie Interesse an Kunst hätten und diese fördern wollten. Die Künstler und Intendanten tun so, als ob sie das glauben würden. Und das vor allem aus dem Bürgertum stammende Publikum verhält sich so, als ob es das Geschehen auf der Bühne ernst nimmt.
Auf diesen Lebenslügen beruht ein großer Teil der öffentlich finanzierten Kunst. Dass der Skandal, den Carp mit ihrem Verhalten ausgelöst hat, nichts mit dem zu tun hat, was auf der Bühne geschieht, ist dafür ein Beleg: Was dort geschieht, ist nicht mehr skandalfähig, weil es kaum noch wahrgenommen wird. Die Ruhrtriennale mit ihren gerade einmal 34.000 Besuchern erreicht weniger Menschen als die dritte Wiederholung einer Kochsendung morgens um drei auf einem Spartenkanal. Würden die Medien nicht über das Festival berichten, es würde im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht existieren.
Skandalfähig war nur, dass Carp sich von Antisemiten erpressen ließ und ihnen nachgab, dass sie ihre Stellung nutzte, um eine der Grundlagen Nachkriegsdeutschlands in Frage zu stellen: die Ablehnung des Antisemitismus. Diese Grundlage ist allerdings nicht verhandelbar, denn ohne sie würde dieses Land in die Barbarei zurückfallen.


Im wesentlichen aufgehängt am Projekt "ruhrtriennale" kann man die IBA nun wirklich nicht behandeln! "Renaturierung der Emscher","Arbeiten im Park","Public -Private-Partnership"waren und sind bis heute erfolgreiche und noch keineswegs abgeschlossene Grossvorhaben der "Internationalen Bauausstellung Emscherpark".Dass gleichzeitig Tourismus und Kulturwirtschaft angekurbelt wurden ,steht auch außer Frage.Zu Einzelheiten verweise ich gern auf meine Erläuterungen in den "Informationen zur Raumentwicklung" der Bundesforschungsanstalt zur Raum-und Landeskunde(Heft 3/4, 1999). Und wenn man sich die "Bilanzen" der ruhrtriennalen unter Mortier,Flimm und zuletzt Simons anschaut, so überwiegen auch hier die positiven Aspekte. Gerade in der Verbindung mit den "Industriedenkmälern" unterscheidet sich die ruhrtriennale eben deutlich von den etablierten Festivals in Europa . Also bitte bei aller Kritik an dem aktuellen Gerangel nicht das Kind mit dem Bade ausschütten!
Manchmal, nein, eigentlich fast immer, habe ich den Eindruck, dass das Ruhrgebiet hier bei Ruhrbarons gerne als ein Gefährt mit dem Motor einer Draisine und den Bremsen eines ICE dargestellt wird, Ruhrpottbashing halt!!
@Tillmann Neinhaus | Ich bin ein Zugereister, der Rückgriff auf die IBA hat mir nochmal deutlich gemacht, welchen praktischen Sinn die Ruhrtriennale hat, dass sie NRW international promotet. Finde ich plausibel, Kunst muss sich vor ihrer Verzweckung nicht fürchten, und Carp legt es ja sehr bewusst darauf an, mit Kunst Politik zu machen. Kürzlich hat Kaeser, der Siemens-Chaf, darauf hingewiesen, dass Rassismus in Deutschland übel ist für alle , die auf Export und internationalen Austausch setzen. Die Frage hier wäre mithin, welchen praktischen Sinn Antisemitismus haben soll? Schlägt sich sowas auf die Bilanzen nieder? Ist das BDS-Modell – Demokratie boykottieren, Autokratien beschweigen – gut fürs Geschäft oder fatal?
Ich meine die Frage nicht polemisch, vielleicht rührt sie an den Kern der Sache: Carp hat (in der SZ) behauptet, würde sie auf BDSler verzichten, könne sie kein internationales Programm mehr machen, nur noch deutsches Zeugs. Frage also: Fördert Carp den Export? Könnte die BDS-Logik – "Kauft nicht beim Juden!" – eine ernstliche Option für die NRW-Wirtschaft sein? Hat es Sinn für Unternehmen in NRW, sich hinter eine solche Strategie zu stellen? Oder hat MP Laschet recht, wenn er sagt, derlei Promo, auf welchem ästhetischen Niveau auch immer, sei für NRW fatal.
Nur so am Rande angemerkt: ein Kumpel hat Verwandtschaft in Wien, die er jährlich besucht. Jedes mal, wenn er wieder nach Hause fährt, stöhnt er: "Scheiß Düsseldorf"! Auch die feine Landeshauptstadt kann mit ihrem neureichen Geschisse und der mäßigen Gastronomie (im bezahlbaten Bereich) einen gehörig auf den Senkel gehen. "Scheiß Düsseldorf "!
@Thomas Wessel Da Israel auf vielen Gebieten in der obersten Liga spielt, wäre ein Boykott Israels nicht nur für NRW äußerst fatal. Die Palästinensergebiete kosten nur, Millionen pro Jahr, ohne jeglichen Nutzen. Diese Alimentierung der Hamas muss endlich ein Ende haben.
Google Alert hat mich auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht, da ich ja darin erwähnt werde. Nun finde ich es generell beachtlich, dass die IBA, inzwischen 30 Jahre nachdem ich sie initiiert habe, immer noch als Aufhänger für verschiede Ruhr betreffende Themen interessant ist. Nicht so schön finde ich, wenn sie weiter nicht verstanden wird oder – was ich nicht unterstellen möchte – fehlinterpretiert wird. Deshalb ganz zu Anfang: Karl Ganser hat alles richtig gemacht und was er angeblich nicht richtig gemacht hat, ist die Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg der IBA: Sie war ein Projekt der Stadtentwicklung und nicht der Wirtschaftsförderung, über die im übrigen nicht viel geschrieben wird, weil sie eben nichts taugte. Dazu möchte ich Karl Ganser selbst zu Wort kommen lassen mit einem Interview aus dem Jahr 2008: „Es gab etwas, was viele Leute so nicht wahrgenommen haben: Die zwei Paradigmen staatlichen Handelns im Nordrhein-Westfalen der achtziger und neunziger Jahre. Das eine war die regionalisierte Wirtschaftspolitik. Das war das Gegenteil von IBA. Da schossen die Technologiezentren, mit EU-Mitteln gefördert, wie Pilze aus dem Boden. Alles sollte sofort zu Arbeitsplätzen führen. Das funktionierte natürlich nicht. Aber dieser Staatsapparat hatte offensichtlich die Fähigkeit, beides, IBA und eine traditionelle Form von Strukturpolitik, parallel zu fahren. So konnte die IBA den Emscher Landschaftspark schließlich auch mit EU- Mitteln bauen. Und wenn der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister glaubte, Technologie-Zentren seien der Stein der Weisen, dann hat die IBA wenigstens dafür gesorgt, dass als Ergebnis ordentliche Immobilien herausgekommen sind. Die Grundsatzkontroverse der damaligen Zeit ist einfach erklärt: Das Ruhrgebiet ist eine Industrieregion, und wer das Ruhrgebiet beschäftigungspolitisch wieder voran bringen wolle, müsse es re-industrialisieren. Die IBA-Position hieß: Das Ruhrgebiet war eine Industrieregion, und das Problem ist, dass es von der Industrie herunterkommen muss. Das waren große ideologische Gräben. Es ist jedoch in den zehn IBA-Jahren gelungen, ein Umdenken einzuleiten; mit derselben Landesregierung und mit demselben Wirtschaftsminister. Heute würde ich formulieren: Es ist uns gelungen, immer mehr Mittel vom orthodoxen Weg auf den nicht orthodoxen Weg umzuleiten. Das heißt, wir haben sehr viele Dinge in der IBA mit Mitteln finanziert, die dafür gar nicht vorgesehen waren. Im Nachhinein betrachtet, zeigt sich da eine erstaunliche, nicht vermutete Liberalität des Staatsapparates.“ Und Ganser fügt hinzu, dass es „übrigens (…) in der Fachliteratur nur wenig reflektiert“ ist: „diese Offenheit eines Staatsapparates, diese Parallelwelten in Abhängigkeit von regionalen und lokalen Interessenskonstellationen, die toleriert oder bedient werden.“ Zum Schluss des Gesprächs macht Ganser implizit deutlich, wie sehr problemgerechtes innovatives Staatshandel von politischen Persönlichkeiten abhängt. Er sagt: Schlimm „fand ich am Ende der IBA den Kurs von Ministerpräsident Clement. Das war kein Rollback, sondern eine ganz schlechte, vordergründig modernistische Regionalpolitik. Das hat mich ganz persönlich getroffen.“ Die IBA war wohl nur mit Johannes Rau als Ministerpräsidenten möglich und mit Ganser, der Fachkompetenz besitzt und integer war. Ganser:
„ Minister Zöpel hat zum Ende der IBA 1999 auf die Frage „Was war das Geheimnis der IBA?“, geantwortet: „Keine Skandale!“ Und tatsächlich: die IBA hat, was keine Selbstverständlichkeit war, trotz ihrer Freiheit und ihres großen Finanzvolumens keine Skandale produziert.“
So ist es sicher richtig, dass die IBA ein Projekt der Regierung Rau war, aber gegen den Widerstand mancher Minister und der Admininistration. Es hat ein Jahr gedauert bis Rau meinem Vorschlag zustimmte.
Im übrigen war die IBA war finanziell ein relativ kostengünstiges Projekt. Die Projektförderung belief sich auf insgesamt 3057, 3 Millionen DM für 123 Projekte in 11 Jahren . das sind pro Jahr 277,9 Millionen DM oder 25,7 Millionen pro Projekt oder umgerechnet etwa 13 Mio. €. Die Umgestaltung des Opel Geländes erfordert ein Mehrfaches dieses Betrags.
Zu ihrer Beurteilung des Engagements für Kultur einer demokratischen Regierung: Kulturpolitik ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, und so gehe ich gern zur Trienale wie in das Schauspielhaus Bochum, sehe aber kaum Fernsehen.
Im übrigen ist Kultur, die vom demokratischen Staat gefördert wird, auf die allgemeinen Menschrechte verpflichtet.
Nota Ebene; Der Slogan "Pott kocht“ ist nicht von Ganser oder der IBA, er ist nur dumm.
Christoph Zöpel
Minister für Stadtentwicklung in NRW 1980-1990.
@ Christoph Zöpel | "Im übrigen ist Kultur, die vom demokratischen Staat gefördert wird, auf die allgemeinen Menschenrechte verpflichtet." – Ja. Und irritierend, weil man dies nun wieder und wieder anmerken muss: dass der Boykott demokratischer Kultur keine ist.